Einführung
Digitales Leben
Die „Schwäbische Zeitung“ zeigt in der Serie „Digitales Leben“ die Auswirkungen auf, die die Digitalisierung nahezu aller Lebensbereiche auf den Alltag der Menschen haben kann.
Ein Storytelling von Yannick Dillinger, Mark Hänsgen, Christin Hartard und Ingrid Augustin
Inhalt

Interview mit Forscher: So leben wir 2040
So leben wir 2040
- Von Yannick Dillinger
So leben wir 2040
So leben wir 2040

Jain! Natürlich wird niemand gezwungen mitzumachen. Etwa jeder siebte Mensch lebt heute noch ohne E-Mail. Das geht. Man überlebt. Man muss nur wissen, dass man sich damit selbst von der Weiterentwicklung der Gesellschaft abschneidet. Irgendwann haben diese Menschen das Gefühl, dass sie weniger wissen als die anderen, dass die Leute nicht mehr mit ihnen reden. Und später stellen sie fest, dass dies nicht nur ein Gefühl ist, sondern die Realität. Dann ist man unwichtig für die Mitmenschen geworden. Und dafür ist man selbst verantwortlich. Ich würde Ihnen empfehlen, Ihre Mutter vor diesem Schritt zu bewahren.
Werden wir konkret: Wie bewegen sich die meisten Menschen im Jahr 2040 fort?
Hauptsächlich mit selbstfahrenden Autos. Sie klicken auf ihr Smartphone, ein selbstfahrendes Auto fährt vor. Sie geben die Zieladresse ein und das Auto fährt sie selbstständig dort hin. Während der Fahrt machen sie ihre Arbeit oder schlafen oder nehmen ein Dinner oder spielen mit ihren Kindern oder tätigen den Einkauf oder lassen sich die Haare schneiden. Jedenfalls werden sie nicht mehr fahren. Das geht auch nicht, denn das Auto wird kein Lenkrad haben.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die meisten von uns diese Autos auch nicht kaufen. Es macht keinen Sinn, dass ein selbstfahrendes Auto 90 Prozent seiner Zeit in der Garage steht. Vermutlich werden die Menschen nicht einmal für die Fahrt von A nach B bezahlen, denn der Fahrpreis wird von jenen Unternehmen übernommen, die ihnen während der Fahrt Werbung zeigen und nützliche Dinge verkaufen. Was viele noch nicht sehen: In dieser Welt wird es keinen Sinn mehr für Taxis, öffentlichen Nahverkehr und die Deutsche Bahn geben. Jedenfalls nicht in der heutigen Art und Weise. Einige der heutigen Mobilitätsunternehmen werden sich radikal neu erfinden müssen.
Thema Arbeitswelt: Müssen sich auch Arbeitnehmer radikal neu erfinden? Wer hat 2040 noch seinen ursprünglichen Job? Der Bankkaufmann?
Der Bankkaufmann ist bis dahin zum Finanzcoach seiner Kunden geworden. Er verkauft nicht mehr sein Wissen über Finanzprodukte, denn die kennt der Computer besser. Der Bankkaufmann begleitet seine Kunden, nimmt sie an die Hand, tritt ihnen in den Hintern und führt sie auf den nächsten zwei, drei Schritten ihrer Entwicklung. Wie es ein Coach eben macht. Das gilt allerdings nur für das Premiumsegment. Im Massensegment wird es keine Bankkaufleute mehr geben, weil Menschen dort der Intelligenz der Computer mehr vertrauen als menschlichen Beratern.
Der Landwirt?
Der Landwirt ist zum hochtechnisierten Computerexperten geworden. Er macht sein Geld nach wie vor in der Pflanzen- und Viehzucht. Aber er ist nicht mehr auf Felder angewiesen. Seine Pflanzen gedeihen unter anderem auch in Stadthäusern, mit technisch optimiertem Licht, Wasser und Boden in mehreren Lagen übereinander und bis zu dreimal im Jahr. Für das Premiumsegment gibt’s dann zwar schon noch die Biobauern, aber „Bio“ bleibt eine Nische.
Der Mechaniker?
Der Mechaniker hat keine allzu rosige Zukunft. In der Produktion übernehmen mehr und mehr vollautomatisierte Maschinen und später auch 3D-Drucker seine Arbeit. Im Service werden nach wie vor Menschen gebraucht. Allerdings benötigen diese kein sehr hohes Ausbildungsniveau, denn alle wesentlichen Handgriffe werden per Augmented Reality-Brille in das Sichtfeld eingespielt. Viele Kunden werden ihre Reparaturen auf diese Weise selbst machen. Andere beauftragen niedrigqualifizierte Reparateure damit.

So leben wir 2040
So leben wir 2040

Wir müssen unterscheiden zwischen den alltäglichen Standardprodukten des Lebens und den besonderen Einmalkäufen. Unsere Standardeinkaufsliste kennt unser Smartphone und sagt uns, wenn etwas fehlt. Es kennt unser Bedürfnisprofil und Geschmacksprofil – im Zweifel sogar besser als wir selbst. Dies wird per Ein-Klick bestellt und nach Hause geliefert. Das klingt vielleicht nicht besonders aufregend, ist aber ungemein nützlich. Die meiste Zeit unseres Alltags verbringen wir mit solchen rationalen Erledigungen. Für die besonderen Käufe werden wir unser Smartphone aber ausschalten. Dann lassen wir uns treiben und überraschen. Dann entdecken wir Neues und probieren Spannendes aus. Unser Smartphone lernt natürlich immer mit. Beim nächsten Mal baut es schon einen neuen Vorschlag in unsere Standardliste ein.
Wie wird unser Essen 2040 produziert?
Im Massenbereich wird es industriell produziert. Der 3D-Druck von Fleisch und anderen Lebensmitteln wird bis dahin im Massenmarkt angekommen sein. Unsere Steaks und Pasta können also im Supermarkt gedruckt werden. Das ist allerdings nur dann nützlich, wenn wir individuelle Nahrungsmittel haben wollen. Also Essen, das an die Biochemie unseres Körpers angepasst ist. Dann analysiert Ihr Smartphone den aktuellen Körperzustand und sagt dem 3D-Drucker, welche Wirkstoffe und Vitamine mit reingedruckt werden müssen. „Medical Food“ gilt unter Nahrungsmittelherstellern gerade als größter Zukunftstrend. Aber auch „Beauty Food“ für Schönheit und „Power Food“ für Körperkraft wird es geben.
Natürlich gibt es auch noch das Premiumsegment. Jeder von uns kann nach wie vor entscheiden, ob er ein natürlich gewachsenes Steak für sechs Euro kaufen will, oder ein individuell gedrucktes für 1,50 Euro. Diese Entscheidung ist eine Frage der eigenen Weltanschauung. Im Aussehen und Geschmack wird man vermutlich kaum Unterschiede feststellen.
Wer achtet 2040 auf unsere Gesundheit?
Wir selbst – mit bester Unterstützung unseres Smartphones. Im Jahr 2040 wird die Analyse unseres kompletten Genoms und Körperzustands nur noch wenige Cent kosten. Nach jedem Toilettengang ist dann die Auswertung des Körperzustands möglich. Diese Informationen laufen im Smartphone zusammen und sagen uns, dass wir an diesem Morgen beispielsweise zu 23 Prozent krank sind. Sie sagen uns auch, wie wir uns verhalten und was wir essen sollen, damit wir morgen nur noch zu 18 Prozent krank sind. Ob wir uns daran halten oder nicht, ist wieder unsere Entscheidung. Aber es wird noch nie so einfach gewesen sein, wirklich gesund zu leben. Man könnte sogar sagen: Krank zu werden zeugt dann von unverantwortlichem Handeln, sich selbst und seiner Umwelt gegenüber.

So leben wir 2040
So leben wir 2040

In Zeiten, in denen Sie mir eine Frage stellen, meine Brille diese Frage mithört, die entscheidenden Keywords extrahiert und mir die Antwort einspielt, noch bevor Sie fertig gefragt haben, wird sich Bedeutung von Faktenwissen verändern. In unseren Studien zur Schule der Zukunft lernen Kinder zwar noch die Grundfächer, aber Faktenfächer wie Geschichte, Geografie oder Biologie spielen dann kaum noch eine Rolle. Stattdessen heißen die Schulfächer „Mut“, „Verantwortung“, „Projektarbeit“, „Teamführung“, „Selbstreflexion“ und natürlich „Programmieren“. Das Coden ist eine der wesentlichen Kulturtechniken der Zukunft.
Werden unsere Kinder durch die digitalisierte Welt schlauer?
Ja, absolut. Selbstverständlich wird jedes Kind der Welt über das Internet den Zugang zu den besten Universitäten und Professoren der Welt haben. Zudem werden wir verstanden haben, wie wir das Potenzial unserer Hirne noch mehr nutzen als heute. Und wir werden Computer haben, die in den meisten Bereichen des Lebens inzwischen intelligenter geworden sind als die Menschen. Alles in allem werden wir in einer Welt leben, in der unsere Kinder wesentlich intelligenter und klüger sein werden als ihre Eltern. Es ist normal, dass diese Vorstellung vielen der heutigen Eltern nicht gefällt.
Werden Gehirne bis 2040 etwa durch einen Computer optimiert?
Nein. Die wissenschaftlichen Zukunftsforscher erwarten die sogenannte Singularität erst zwischen 2050 und 2090. Das ist jener Zeitpunkt, an dem der erste Computer die menschliche Durchschnittsintelligenz erreicht. Bis dahin gibt es keinen wesentlichen Grund zur Optimierung des menschlichen Gehirns, jedenfalls nicht durch Computer. Danach allerdings könnte es allerdings schnell gehen. Dann werden Computer übermenschlich intelligent und wir zur zweitintelligentesten Spezies auf dieser Welt werden.
Wir haben über die Zukunft des Bankkaufmanns, des Landwirts und des Mechanikers gesprochen. Wie sieht die Zukunft für uns beide aus? Werden Interviews wie dieses 2040 zwischen Robotern stattfinden?
Wenn Sie 2040 einen Experten über die Zukunft befragen wollen, dann rate ich Ihnen unbedingt, einen Roboter zu befragen. Denn der wird Ihnen bessere Analysen geben als jeder menschliche Zukunftsforscher. Das ist nicht schlimm. Unser beider Job wird sich nur verändert haben. Sowohl Journalisten als auch Wissenschaftler sind dann vom Experten und Wissensvermittler zum Coach geworden. Wir werden nicht mehr dafür bezahlt werden, am meisten Wissen zu generieren, zu selektieren und weiterzugeben, sondern dafür, die Menschen an die Hand zu nehmen, sie zu motivieren, ihnen in den Hintern zu treten und sie auf den nächsten Schritten ihrer Entwicklung zu begleiten. Wenn Sie so wollen: Wir nutzen dann die Computerintelligenz zu unserem Vorteil und setzen das „menschliche“ obendrauf.
Nun ist es aber so, dass einige Menschen Angst haben vor allzu großen Veränderungen...
Die menschliche Historie besteht aus permanenten Veränderungen. Ob man das gut findet, muss jeder selbst wissen. Ich bin da Optimist, weil ich glaube zu wissen, dass die Menschheit klug genug ist, ihr Leben konstant zu verbessern. Wenn wir es klug anfangen, dann werden wir 2040 dank der Digitalisierung die großen Probleme der Welt gelöst haben: den Hunger, die Wasserknappheit, die Energie und die Kriege. Auch die großen Krankheiten werden ausgelöscht sein. Die Menschen werden länger leben. Natürlich sorgt das für neue Probleme, aber die meisten Menschen werden zurückschauen und sagen, dass es gute Jahre waren.

Um externe Dienste auszuschalten, hier Einstellungen ändern.
Besuch in der Fantastischen Bibliothek: Die erfundene Realität
Die erfundene Realität
- Von Benjamin Wagener
Die erfundene Realität
Die erfundene Realität

Ersonnen hat all diese Techniken, die ohne die digitale Verarbeitung von Daten nicht denkbar wären, der amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Robert Zemeckis vor fast 30 Jahren. „Zurück in die Zukunft II“ kam 1989 in die Kinos – zu einer Zeit, als Telefone noch analog und mit Wählscheibe funktionierten und Sekretärinnen monochrome Monitore benutzten, die nur eine einzige Farbe darstellen konnten.
Auch wenn Zemeckis in anderen Dingen völlig falsch lag – nach wie vor gibt es keine schwebenden Skateboards, Autos klappen ihre Räder weiterhin nicht ein, um durch die Luft zu fliegen, und Turnschuhe, die ihre Laschen von allein schließen, sind noch immer ein Traum – bewies der damals 37-Jährige doch erstaunlich prophetische Fähigkeiten. Für eine Komödie mit Science-Fiction-Elementen nahm er digitale Techniken vorweg, die heute Standard sind oder vor dem Durchbruch stehen.
Robert Zemeckis steht nicht alleine da. Immer wieder haben Drehbuchautoren und Schriftsteller in ihren Werken über die Zukunft und die Techniken nachgedacht, die das Leben der nachfolgenden Generationen bestimmen können. Und immer wieder sind sie der Realität erstaunlich nahegekommen.
QUIZ
Welche SF-Idee musste am längsten auf ihre Verwirklichung warten?
http://plbz.it/2e4zDdj

Die erfundene Realität
Die erfundene Realität

Wer in Wetzlar die Zukunft sucht, betritt allerdings erst mal eine Villa der Gründerzeit. Seit einigen Jahren im früheren Staatsbauamt untergebracht, prägen dunkles Holz, knarzende Treppen und viele kleine Räume mit hohen, schlanken Holzregalen die Bibliothek am Rande der Altstadt der 50000-Einwohner-Stadt. In dem fünfgeschossigen Haus befindet sich die „weltweit größte öffentlich zugängliche Sammlung fantastischer Literatur“ – und dazu zählt der Leiter und Gründer Thomas Le Blanc die Genres Science-Fiction, Utopie, Fantasy, Horror, Fantastik, Märchen, Sagen und Mythen sowie Reise- und Abenteuerliteratur. „Wir sammeln alles, in dem etwas drin ist, was nicht realistisch ist“, sagt Le Blanc.
Datenbank sammelt Intelligenz der Schriftsteller
Oder noch nicht realistisch: Denn in der Science-Fiction gibt es unzählige Beispiele von von Schriftstellern ersonnenen Gedanken, die zum Zeitpunkt der Niederschrift utopisch gewesen, Jahre später aber Grundlage für neue Techniken geworden sind. Deshalb sammelt Thomas Le Blanc mit seinem Team nicht nur Zukunftsliteratur, sondern wertet sie aus, speichert und ordnet die gefundenen Informationen in Datenbanken nach verschiedenen Themengebieten. „Wir greifen auf die gesammelte Intelligenz der weltweiten Science-Fiction-Autoren zurück, um so die Beschreibung der möglichen Zukunft zu entwickeln“, sagt Le Blanc.
„Future Life“ nennt der 65-Jährige sein Projekt, mittlerweile berät der gebürtige Wetzlaer Dax-Konzerne und Ministerien genauso wie kleine Mittelständler und Start-ups. Vor allem Unternehmen aus der Automobil-, Chemie- und Medizinindustrie, aber auch Banken, Versicherungen, Energiekonzerne und Kommunikationsfirmen gehören zu den Kunden der Phantastischen Bibliothek.

Die erfundene Realität
Die erfundene Realität

Mit seinen Mitarbeitern erstellt Le Blanc so aus Tausenden von literarischen Texten detaillierte, branchenspezifische Zukunftskonzepte – alle basierend auf den Ideen der Science-Fiction-Autoren. „Was ich beschreibe, ist aber nicht nur die Technologie, sondern auch die damit einhergehende Veränderung in der Gesellschaft“, erzählt der Bibliothekschef. Tauche eine Idee bei mehreren Autoren auf, sei sie wahrscheinlicher als abseitige Einfälle, die nur einzelne Schriftsteller in ihren Romanen verwendet haben.
Seit 50 Jahren ist die Zukunft digital
Dabei ist eine Sache klar: Die Literatur ist ein Spiegel der Realität – und nirgendwo ist das offensichtlicher als bei der Revolution der Digitalisierung, die seit der Jahrtausendwende alle Bereiche der modernen Gesellschaft von Grund auf verändert. Auch in den Geschichten der weltweiten Gemeinde der Science-Fiction-Autoren ist die Zukunft digital – und zwar seit mehr als 50 Jahren. „Im sogenannten Goldenen Zeitalter der Zukunftsliteratur in den 1940er- und 50er-Jahren in den USA waren die beschriebenen Rechenmaschinen noch riesige Geräte, die in Kellern und Lagerhallen standen – und mit kilometerlangen Lochkartenstreifen bedient wurden“, erklärt Le Blanc. Die große Wende vollzog sich in den 1960er-Jahren mit der von Gene Roddenberry erdachten amerikanischen Fernsehserie „Raumschiff Enterprise“. „Von da an entwickelten die Autoren die Vorstellung von riesigen digitalen Datenmengen, die in viel größerem Rahmen gespeichert und mit verschiedenen Geräten vernetzt werden konnten“, sagt Le Blanc. Eben die Vorstellung, die nun die weltweite technologische Entwicklung bestimmt.
Viele dieser Ideen, die Schriftsteller aus der ganzen Welt seit den Tagen ersonnen haben, als das Raumschiff Enterprise erstmals aufbrach, um „neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen“, sind in exakt den Datenbanken der Phantastischen Bibliothek verzeichnet – geordnet nach Kategorien wie Mobilität, Wohnen, Energieversorgung, Gesundheit, Nahrung oder Arbeitswelt.

Die erfundene Realität
Die erfundene Realität

Politik erhofft sich neue Denkansätze
Vor zwei Jahren bot die Phantastische Bibliothek für einen mittelständischen Bauunternehmer, der mehrere kleinere Handwerksfirmen übernommen hatte, eine Weiterbildung an, um die Mitarbeiter sensibel für die Trends des vernetzten Hauses zu machen. „Der Chef wollte von mir eine Vision, wie die Menschen in 30 Jahren leben werden“, erklärte Le Blanc. Und der Institutschef begann mit dem Handwerker zu arbeiten, indem er die literarischen Visionen mit der Wirklichkeit abglich. „Es ging um die Türen, die sich mit Augenabgleich und Fingerabdrücken und nur bei autorisierten Personen öffneten“, erzählt Le Blanc. „Um eine künstliche Intelligenz, die nicht nur Fenster, Heizung und Waschmaschine steuert, sondern auch einkauft und Putzroboter steuert.“
Für das hessische Wirtschaftsministerium hat Le Blanc vor zwei Jahren ein Dossier über Nanotechnologie erarbeitet – also aus Tausenden Büchern zusammengetragen, was Literaten über winzige Geräte und Instrumente mit großer Wirkung geschrieben haben. „Natürlich liefert Literatur keine fertigen Blaupausen“, erklärt Hessens Wirtschaftsminister Tarek al-Wazir, der die Studie in Auftrag gegeben hat. „Wohl aber kann sie Anstöße geben für neue Denkansätze und Herangehensweisen.“
Der Grund dafür, dass die moderne Gesellschaft viel von Sciene-Fiction-Autoren lernen kann, liegt in der Tatsache, dass die Literaten zumeist nicht einfach vor sich hin fabuliert haben. „So viele Autoren kommen aus der Forschung und Wissenschaften, sie haben die aktuellen Theorien ihrer Zeit zur Kenntnis genommen und an der Stelle zu erzählen begonnen, an der sie bei ihrer Forschungsarbeit nicht weiterkamen“, erläutert Thomas Le Blanc.

Die erfundene Realität
Die erfundene Realität

Vorhersagen des Jules Verne
Dass Schriftsteller wie Jules Verne bei ihren Geschichten die Wirklichkeit oft sehr präszise vorausgesagt haben, wundert Kaku nicht. So habe Verne klar realisiert, dass die Naturwissenschaften der Motor waren, der die Fundamente der Zivilisation erschütterte. Im 1863 geschriebenen Zukunftsroman „Paris im 20.Jahrhundert“ beschreibt der Autor die französische Hauptstadt als Metropole mit verglasten Wolkenkratzern, Klimaanlagen und Fernsehern, mit Aufzügen, Hochgeschwindigkeitszügen und benzingetriebenen Automobilen.
Zwei Jahre später kommt Verne der Realität noch weit näher. In dem 1865 verfassten Roman „Von der Erde zum Mond“ beschreibt er detailliert die Reise, die US-Astronauten 1969 – also mehr als 100 Jahre später – auf den Mond brachte. „Er sagte die Größe der Raumkapsel bis auf wenige Prozent Abweichung präzise voraus, ebenso die Lage des Startplatzes in Florida nicht weit von Cape Canaveral, die Zahl der Astronauten der Mission, die Flugdauer, die Schwerelosigkeit, die die Astronauten erleben würden und schließlich die Landung im Wasser“, erläutert Kaku. Vernes größter Irrtum sei gewesen, dass er Schießpulver statt Flüssigtreibstoff benutzte, um die Rakete zum Mond zu bringen. Die Grundlage dieser Verne’schen Prognosen waren dabei Gespräche mit Wissenschaftlern, die Verne besuchte und nach ihren Visionen für die Zukunft befragte.
Die Realität ist oft schneller
In der Regel sind solche Visionen und die daraus resultierenden Geschichten über die Zukunft sogar weniger fantasievoll als die Wirklichkeit selbst. „Vorhersagen über die Zukunft haben, von wenigen Aussagen abgesehen, die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts immer unterschätzt“, sagt Michio Kaku. Der Lieblingsbeweis des Starphysikers: „Raumschiff Enterprise“.
Als die ersten Folgen der Serie in den 1960er-Jahren zu sehen waren, staunten die Zuschauer über Handys, transportable Computer, sprechende Apparate und Maschinen, die gesprochene Wörter in Texte transkribieren konnten. Für den Schöpfer der Serie war das, so Kaku, die „Technologie des 23. Jahrhunderts“. Für die Besitzer eines Smartphones ist es in heutigen Zeiten Alltag.

Auf diese Idee mussten wir am längsten warten
Auf diese Idee mussten wir am längsten warten
Auf diese Idee mussten wir am längsten warten

Der Countdown von Ingrid Augustin verrät Ihnen, auf welche „phantastische“ Idee wir am längsten haben warten müssen. Übrigens: Die ersten drei Plätze belegt ein einziger Autor. Wer das ist, wird natürlich nicht verraten. Kleiner Tipp: Er war Franzose.
Im Übrigen haben die Schriftsteller nicht nur Technik und Technologien beschrieben. So mancher hatte sich auch gesellschaftliche Entwicklungen, wie beispielsweise die Europäische Union ("Morgenwelt" von John Brunner), Verbrechen der Zukunft, wie zum Beispiel Hacker ("Neuromancer" von William Gibson) oder den ungewöhnlichen Freizeitspaß "Weltraum-Tourist" ("Im Mondstaub versunken" von Arthur C. Clarke) ausgedacht.
Hier geht es zur Countdown-Liste

Neue Sicht der Dinge: Die virtuelle Realität
Die virtuelle Realität
- Von Daniel Drescher
Die virtuelle Realität 3-D-Forscher Dmitri Popov über Anwendungsgebiete und Risiken des Virtual-Reality-Trends
Die virtuelle Realität 3-D-Forscher Dmitri Popov über Anwendungsgebiete und Risiken des Virtual-Reality-Trends

Anfang der 1990er-Jahre gab es zwei technische Probleme, die man inzwischen gelöst hat. Die Auflösung war katastrophal im Vergleich zu heute, die Bilder konnten nicht in einer überzeugenden Qualität geliefert werden. Zudem war die Synchronisierung von Bewegung und Bild nicht gut. Zum Medium an sich kann man sagen, dass es immer so ist: Bei neuen Technologien, denkt man, dass sie die ganze Welt verändern und dass sie überall und in jedem Bereich einsetzbar wären. Aber dann stellt man fest, es ist nicht so und wird enttäuscht. Auf diese Phase folgt dann aber eine produktive, da findet man die Nischen, in denen man neue Geräte einsetzen kann. Ich bin mir sicher, dass Virtual Reality nicht den Film ersetzen wird. Es ist Quatsch, das zu glauben. Es wäre auch unsinnig anzunehmen, wie Facebook-Chef Mark Zuckerberg gesagt hat, dass man bald keine Computer oder Laptops mehr braucht, weil alles über Head Mounted Displays laufen wird. Vielleicht werden die Geräte in zehn Jahren so weit sein, aber momentan sehe ich das nicht.
Für welche Anwendungsgebiete hat VR den größten Nutzen?
Alle Medien versuchen, dieses „Being-there“-Gefühl, diese Telepräsenz, herzustellen. Ich sitze in einem Sessel, glaube aber nicht hier zu sein sondern auf einem anderen Planeten. Militär und Raumfahrt werden VR auf jeden Fall nutzen, bevor man ein kostspieliges Manöver auf einem realen Schlachtfeld realisiert, trainiert man lieber im virtuellen Raum. Preistechnisch ist das kein Vergleich zu jeder realen Anwendung. Aber auch Medizin: Wenn Studenten alle wichtigen Operationen mit VR-Brillen durchspielen können, ist das natürlich ein unglaublicher Zugewinn, der Risiken minimiert. Das Feld der Psychotherapie ist übrigens für VR auch ganz wichtig. Es gibt gerade für Menschen mit Depression spezielle VR-Angebote, sehr spannend. Das wichtigste Geschäftsfeld für VR liegt im B2B-Bereich. Als Baukranhersteller etwa muss ich den Kran nicht mehr auf die Messe mitnehmen, kann dem Kunden aber dank Virtual Reality einen Eindruck vom Produkt verschaffen.

Die virtuelle Realität
Die virtuelle Realität

Was die Auswirkungen von VR auf den Menschen angeht, gibt es bisher so gut wie keine Studien, auch im Bereich Marketing. Die Hochschule Fresenius führt Gespräche mit einem Automobilhersteller, ob wir gemeinsam so eine Untersuchung machen. Es geht darum, wie ein VR-Erlebnis die Kaufentscheidung des Kunden beeinflusst. Der ganze Markt wartet auf diese Zahlen.
Zu den Gefahren: Die sind vorhanden, und die Diskussionen werden geführt. Wenn wir wieder einen Amoklauf erleben und es stellt sich heraus, dass der Täter eine VR-Brille besaß, wird diese Frage aufkommen, ganz klar. Ich bin ziemlich skeptisch, dass es eine direkte Verbindung zwischen der kriminellen Tat eines jungen Menschen und virtuellen Erlebnissen gibt. Mit meinen Studenten diskutiere ich dieses Thema gern, die Klassen sind geteilter Meinung. Manche sind überzeugt, dass es eine negative Wirkung gibt, aber wenn man selbst Gamer ist, verteidigt man das Medium Computerspiele. Die Frage bleibt offen, und ich bin mir nicht sicher, ob bei den Diskussionen ein brauchbares Ergebnis herauskommt. Wirtschaftlich gesehen wird VR im Gaming-Bereich eine Nische bleiben.
Wo sehen Sie weitere Risiken?
Es gibt noch einige Probleme, vor allem gesundheitliche Fragen: Es gibt Menschen, die finden das VR-Erlebnis unangenehm – bis hin zu Kopfschmerzen und Erbrechen. Da ist noch große Unsicherheit vorhanden. Man sollte sehr genau untersuchen, welche Auswirkungen das medizinisch hat, wie etwa Augen und Hirn auf VR reagieren. Natürlich muss man auch Risiken im Bereich der psychischen Gesundheit untersuchen, momentan gibt es da einfach noch keine Antworten.
Auf einer Zeitleiste – wo stehen wir?
Wir sind mittendrin. Wenn man es mit dem Film vergleicht, sind wir nicht mehr bei den Brüdern Lumière und dem Zug, der die Kinozuschauer erschreckt hat. Aber noch sind wir im Stadium des Schwarzweiß- und Stummfilms. Wenn die kreierten 3-D-Wirklichkeiten und die normale Umgebung richtig kombiniert werden, dann wird es interessant.

So berichtet Galileo über Virtual Reality
Um externe Dienste auszuschalten, hier Einstellungen ändern.
Online Banking im Süden: Das entmenschlichte Bankgeschäft
Das entmenschlichte Bankgeschäft
- Von Andreas Knoch
Das entmenschlichte Bankgeschäft
Das entmenschlichte Bankgeschäft

Der Unterschied zwischen beiden Szenarien lässt sich auf ein einziges Wort reduzieren: Digitalisierung. Immer mehr Menschen nutzen inzwischen die Möglichkeiten, Bankgeschäfte entweder online auf dem heimischen PC oder mobil mit dem Smartphone zu erledigen – und tauchen dementsprechend seltener am Bankschalter auf. Dass dies kein subjektiver Befund anhand eines stichprobenartigen Filialbesuchs ist, belegen Zahlen des Sparkassenverbands. In den deutschlandweit gut 400 Sparkassen wurden dieses Jahr über einen Zeitraum von zwei Monaten sämtliche Geschäftsvorfälle – online wie offline, also vor Ort in der Filiale – registriert und ausgewertet. Herausgekommen ist ein Verhältnis von 1 zu 190. Einem Filialbesuch stehen also 190 digitale Geschäftsvorfälle gegenüber – angefangen von der Benutzung des Geldautomaten bis hin zur Überweisung per Smartphone-App.

Das entmenschlichte Bankgeschäft
Das entmenschlichte Bankgeschäft

Nach der Musik-, Film- und Medienbranche hat die digitale Revolution auch die Finanzwelt fest im Griff. Vor allem im Zahlungsverkehr hat sich in den vergangenen Jahren Erhebliches getan. Bargeldlose Überweisungen und Geldbewegungen überstiegen im Jahr 2015 die Zahl von 426 Milliarden Transaktionen weltweit. Die Gründe für die Zunahme der digitalen Zahlungen sind vielfältig. Eine große Rolle spielt der technologische Fortschritt in der Sicherheitstechnologie von Kredit- und Cashkarten und in der Biometrie. Hinzu kommen steigende Kosten für Barzahlungen. Gleichzeitig drängen neue Anbieter wie Direktbanken und branchenfremde Wettbewerber mit neuen, innovativen Lösungen in einen Markt, der bisher fest in den Händen der Sparkassen und Genossenschaftsbanken war.
Bestes Beispiel: der Bezahldienst Paypal, der sich innerhalb weniger Jahre zur Nummer zwei im deutschen Onlinehandel aufgeschwungen hat. Von den knapp 33 Milliarden Euro, die die 1000 größten Onlineshops hierzulande im Jahr 2015 umgesetzt haben, wurde ein Fünftel über Paypal abgerechnet. Mit dem Onlinebezahldienst Paydirekt wollen die deutschen Geldhäuser dem übermächtigen Anbieter Paypal jetzt zu Leibe rücken. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Noch ist der Abstand groß: Während die mehr als 16Millionen Kunden des US-Anbieters in Deutschland in über 50000 Onlinegeschäften zahlen können, hat Paydirekt erst 260 Händler angebunden und eigenen Angaben zufolge 650000 registrierte Kunden. Für einen Erfolg von Paydirekt müssen zwingend noch die großen Versender wie Amazon und Ebay oder in Deutschland Zalando und Otto gewonnen werden. „Da haben wir zu spät reagiert, das passiert uns kein zweites Mal“, gibt Pumpmeier zu.

Das entmenschlichte Bankgeschäft
Das entmenschlichte Bankgeschäft

Wie solche Kooperationen aussehen zeigt exemplarisch das Beispiel Fotoüberweisung. Die Smartphone-App, entwickelt von einem Finanz-Startup aus München, macht Fotos einer Rechnung in Papierform, extrahiert daraus die entsprechenden Informationen zur Überweisung und verknüpft den Nutzer automatisch mit der eigenen Banking-App. So muss man im besten Fall nur noch eine Transaktionsnummer eingeben, und der Rechnungsbetrag ist in aller Kürze überwiesen. In Deutschland gibt es 350 solcher Fintechs, kleine wendige Unternehmen ohne den organisatorischen und aufsichtsrechtlichen Ballast der traditionellen Institute, die mit den Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung im Finanzwesen spielen. Davon wird nur ein Bruchteil überleben, längst nicht alle Applikationen werden sich beim Kunden durchsetzen. Doch die Innovationskraft dieser Anbieter macht den etablierten Banken und Sparkassen Beine.

Das entmenschlichte Bankgeschäft
Das entmenschlichte Bankgeschäft

Doch gleichzeitig werden die Angebote im Netz immer größer, die Technologien ausgereifter. Banken experimentieren heute mit Videochat und Avatarberatung, wo eine Kunstfigur den Bankkunden durch die virtuelle Welt lotst. Auch der Einsatz künstlicher Intelligenz wird erprobt. Der von IBM entwickelte Supercomputer Watson etwa hat kognitive Fähigkeiten, die dem eines Menschen ähneln. Er in der Lage, selbstständig Informationen aus Daten zu gewinnen und daraus Schlüsse zu ziehen. IBM arbeitet bereits mit Finanzinstituten zusammen, um Watson im Bankgeschäft zu trainieren – etwa im Bereich der Anlageberatung. Es gibt wenig Argumente, warum nicht auch komplexere Bankgeschäfte künftig online möglich sein sollten.
So schön und bequem die neue Welt für die Kunden ist, die Banken und Sparkassen stellt das vor enorme Herausforderungen. Die Institute müssen ihren Kunden heute auf vielen Wegen den Zugang zu Bankdienstleistungen bieten – per Telefon, online, mobil und in der Filiale vor Ort. Multikanalbank heißt das auf neudeutsch. „Das fordert uns als Bank einerseits, macht das Geschäft andererseits aber auch unwahrscheinlich spannend. Denn der Bankberater muss heute nicht nur das klassische Bankgeschäft beherrschen sondern auch technologisch fit sein – sich mit Smartphone-Apps auskennen und diese Anwendungen Kunden erklären können“, sagt Schmid. Dass die Beratung perspektivisch „entmenschlicht“ wird, glaubt der Banker nicht. „Digitalisierung braucht den Menschen. Mit einem Algorithmus wird man menschliche Fähigkeiten niemals ersetzen können.“

Kriegsführung 2.0: Das unsichtbare Schlachtfeld
Das unsichtbare Schlachtfeld
- Von Ludger Möllers
Das unsichtbare Schlachtfeld
Das unsichtbare Schlachtfeld

Ein frei erfundenes Szenario. Aber ein Szenario mit realistischem Hintergrund. Ein paar Beispiele: Unbekannte Hacker, möglicherweise aus den Reihen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), haben vor einigen Monaten stundenlang den französischen Sender TV5 Monde lahmgelegt. Der Bundestag war im vergangenen Jahr Ziel der sogenannten „Sofacy“-Attacken, nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden flossen große Datenmengen.
Professorin Gabi Dreo Rodosek vom neuen Forschungszentrum Cyber Defence der Universität der Bundeswehr in München sagt: „Die Informations- und Kommunikationstechnik durchdringt alle Bereiche moderner Gesellschaften und ist die Basis einer digitalen Gesellschaft. Dabei ist jedes IT-System potenziell angreifbar. Alle Bereiche der digitalen Gesellschaft sind somit auch potenziell gefährdet. Insbesondere sind kritische Infrastrukturen wie unter anderem Stromnetze, sogenannte Smart Grids, Flughäfen oder Atomkraftwerke im Fokus der Angreifer.“

Das unsichtbare Schlachtfeld
Das unsichtbare Schlachtfeld

Zwar spricht niemand offen über Krieg gegen Deutschland, Gabi Dreo Rodosek aber warnt: „Cyber-Attacken sind bereits heute Teil der Kriegsführung. Angriffe auf die virtuelle Welt, ob für militärische, kriminelle oder terroristische Zwecke, sind allgegenwärtig.“ Darum müssen nach Meinung fast aller Experten die Betreiber von Kraftwerken und Stromnetzen, Flughäfen und Bahnanlagen mehr als bisher tun, um auf Angriffe vorbereitet zu sein. Dreo Rodosek: „Hierbei besteht Nachholbedarf, beginnend bei der Entwicklung von adäquaten IT-Sicherheitslösungen, -konzepten und -strategien bis hin zur Stärkung des Sicherheitsbewusstseins jedes Einzelnen.“
Um Angriffen aus dem Cyber-Raum auf Computernetzwerke des Bundes und auf eigene IT-Strukturen effektiver begegnen zu können, soll die Bundeswehr jetzt ihre Fähigkeiten in einer neuen Cyber-Truppe bündeln. In der vergangenen Woche ernannte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen einen Spezialisten für elektronische Kampfführung, Generalmajor Ludwig Leinhos (60), zum künftigen Inspekteur für die neue Einheit zur Abwehr von Angriffen aus dem Internet. Von der Leyen nimmt das Thema ernst: Zu Land, zu Wasser und in der Luft sind nach klassischem, aber überholtem Denkmuster Heer, Marine und Luftwaffe für die Verteidigung zuständig. Doch durch die digitale Entwicklung kommt eine vierte Teilstreitkraft für den Cyber-Raum hinzu: 13500 Soldaten und Zivilisten sollen dort kämpfen können.

Das unsichtbare Schlachtfeld
Das unsichtbare Schlachtfeld

Der optimistischen Einschätzung des Generals widerspricht der renommierte finnische Sicherheitsexperte Mikko Hypponen. Erst im Sommer hatte Hypponen verdeutlicht, dass die Bundeswehr im Konzert der Cyber-Großmächte derzeit nicht mitspielen könne. Die erste Geige spielten die USA, gefolgt von Israel, China und Russland. Allerdings sei es schwierig, Cyber-Attacken einer Nation zuzuweisen, weiß Hypponen: Verschleierung ist Teil des Angriffs.
Eine wichtige Rolle bei der Aufholjagd der Bundeswehr kommt der Universität der Bundeswehr in München zu. Dort entsteht das deutschlandweit größte und modernste Cyber-Forschungszentrum. Auch ein Masterstudiengang „Cyber-Sicherheit“ ist beschlossene Sache. Im Januar 2018 legen 70 Studierende los, überwiegend angehende Offiziere, die nach Abschluss ihr Spezialwissen dem Cyber-Zentrum der Bundeswehr zur Verfügung stellen sollen.

Das unsichtbare Schlachtfeld
Das unsichtbare Schlachtfeld

Und für den Fall, dass Deutschland angegriffen wird und das öffentliche Leben zum Stillstand kommt? Was passiert, wenn eine fremde Macht großflächig IT-Systeme attackiert? General Leinhos verweist auf die Nato. Das Bündnis werde einen Cyber-Angriff auf eines seiner Mitgliedsländer nach Artikel 5 des Nato-Vertrages behandeln und als Angriff gegen alle Mitgliedsnationen ansehen. Diese Qualität eines Angriffes sei bisher noch nicht eingetreten. Aber die Bundeswehr werde im Falle eines solchen Angriffes entsprechende Mittel zur Verfügung stellen. Zunächst aber sei zu klären, so Leinhos, wer und mit welchem Ziel den Angriff führe und sich dahinter verberge, bevor die Nato agieren könne.

Das unsichtbare Schlachtfeld
Das unsichtbare Schlachtfeld

Die Bundeswehr übt schon seit vielen Jahren auch Cyber-Angriffe. Eine kleine, geheim agierende Einheit namens Computer-NetzwerkOperationen in Rheinbach bei Bonn mit rund 60 Soldaten ist dafür zuständig. Ein Einsatz dieser Einheit – etwa das Überwinden der Schutzsysteme eines Gegners – müsste aber vom Bundestag genehmigt werden – wie Kampf- oder Stabilisierungseinsätze in Afghanistan oder Mali. Die Ravensburger Grünen-Bundestagsabgeordnete und verteidigungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, Agnieszka Brugger, fordert: „Für eine effektive demokratische Kontrolle ist es unerlässlich, dass das Parlament in Zukunft über die konkreten Details von Operationen der Bundeswehr im Netz besser und transparenter informiert wird.“
Cyber-Angriffe auf Atomkraftwerke, Eingriffe ins Netzwerk von Parlament und Regierung, Hacker-Operationen deutscher Soldaten im Ausland: Das Spannungsfeld dürfte sich in Zukunft ausweiten. Die Diskussion über die Kriegführung 2.0 beginnt gerade erst.

Um externe Dienste auszuschalten, hier Einstellungen ändern.
Wie verändern sich Beziehungen durch das Digitale?
Wie verändern sich Beziehungen durch das Digitale?
- Von Jasmin Off
Wie verändern sich Beziehungen durch das Digitale? Wissenschaftlerin Ulrike Klinger über digitale Kommunikation und warum wir nicht mehr als 150 Kontakte pflegen können
Wie verändern sich Beziehungen durch das Digitale? Wissenschaftlerin Ulrike Klinger über digitale Kommunikation und warum wir nicht mehr als 150 Kontakte pflegen können

Ganz massiv, und es verändert sich stetig weiter. Kommunikationsforscher operieren quasi am offenen Herzen. Die größten Veränderungen sind: Wir kommunizieren insgesamt mehr und mehr im öffentlichen Raum. Kommunikation, die mal privat war, verlagern wir in eine Semi-Öffentlichkeit. Wir besprechen die Dinge nicht mehr nur in einem Raum, an einem Tisch oder am Telefon, sondern führen unsere Beziehungen auf kommerziellen Plattformen. Da sind wir aber nicht untereinander, sondern auch andere können mitlesen und unsere Unterhaltungen verfolgen. Und die Unternehmen, die hinter den Plattformen stehen, leben natürlich davon, dass wir unsere Kommunikation über sie abwickeln, denn sie können diese monetarisieren. Wir bezahlen im Internet nicht mit Geld, sondern mit Daten.
Das klingt beängstigend ...
... aber wir wollen das ja auch. Das ist der Deal, den wir gemacht haben und niemand würde gerne für Google oder Facebook bezahlen wollen. Grundsätzlich schwingen bei dem Thema zwei Missverständnisse mit: Das erste ist, wir denken oft, dass eine Kraft von außen auf unser Kommunikationsverhalten Einfluss nimmt. Aber: Wir alle sind Teil der Digitalisierung, wir machen mit, wir treiben die Möglichkeiten voran und nutzen sie. Das zweite Missverständnis betrifft die Option, noch auszusteigen. Aber Fragen wie „Wollen wir das überhaupt?“ sind überflüssig. Der Wandel ist so massiv, vergleichbar mit der Industrialisierung. Wir stecken mittendrin und werden die Entwicklung auch nicht aufhalten können.
Müssen wir ein anderes Verständnis von Privatsphäre entwickeln?
Das haben wir bereits. Es ist aber nicht so, dass Internetnutzer keine Ansprüche an ihre Privatsphäre haben. Aber posten, teilen, twittern gilt für sie nicht als private Handlung.

Wie verändern sich Beziehungen durch das Digitale?
Wie verändern sich Beziehungen durch das Digitale?

Weder noch. Wir kommunizieren einfach über vielfältigere Formen. Vielleicht gibt es weniger gesprochenes Wort, aber zählt man alle Nachrichten zusammen, die wir täglich mit allen über alle Tools austauschen, ist das schon ganz ordentlich.
Aber verlernen wir, echte Kommunikation zu betreiben?
Das hängt von den Leuten und der Situation ab. Manche Menschen sind sehr schüchtern und wollen jemanden kennenlernen, da ist eine Onlineplattform ideal. Für extrovertierte Menschen ist dagegen eine Bar super. Plattformen wie Parship und Apps wie Tinder sind eine spannende Sache, aber die Frage ist, wie lässt sich Qualität sicherstellen. Der Vorteil der Bar ist: Wir wissen zumindest, dass es echte Menschen sind, mit denen wir kommunizieren.
Und im Netz?
Bei Onlineplattformen und in sozialen Netzwerken haben wir mittlerweile eine große Zahl von Bots- Software die darauf programmiert ist, menschliches Verhalten zu imitieren. Die können Sie nicht identifizieren, die kommunizieren mit Ihnen wie echte Menschen. Die Künstliche Intelligenz ist so fortgeschritten, dass Sie das gar nicht merken. Diese Bots sind aber natürlich auch nach bestimmten Interessen programmiert und können auf kommerziellen Seiten manipulativ wirken. Das ist die unschöne Seite der vermehrten digitalen Kommunikation.

Wie verändern sich Beziehungen durch das Digitale?
Wie verändern sich Beziehungen durch das Digitale?

Psychologische Studien sagen, dass wir etwa 150 sinnvolle Kontakte habnen können, also so, dass die Beziehung noch mit Inhalt gefüllt ist. Mehr schaffen wir kognitiv nicht. Die durchschnittliche Zahl der Facebookfreunde liegt aber bei etwa 350. In den sozialen Netzwerken knüpfen wir viele „weak ties“ – Verbindungen mit Menschen, mit denen uns nur eine Sache verbindet, etwa der gemeinsame Schulbesuch oder der letzte Skiurlaub. Diese Beziehungen brechen wir auch relativ schmerzlos wieder ab. Uns mit diesen Menschen zu vernetzen, erweitert aber unseren Horizont. Wir erleben eine größere Vielfalt an Meinungen und das ist spannend, denn die Leute, die wir öfter persönlich treffen – Freunde, Familie – die sind uns oft sehr ähnlich.
Wie verändert sich denn die Beziehung zur Familie, etwa durch WhatsApp-Gruppen mit Eltern?
Das verändert gar nicht so viel. Ob wir nun telefonieren oder whatsappen, ist nicht so entscheidend. Klar ist: Die Jungen suchen sich die Netzwerke, in denen die Eltern nicht sind, da man nicht von ihnen beobachtet werden möchte. Das sehen wir bei Facebook, das nicht mehr das coole Netzwerk ist, sondern das, in dem sich jetzt die Eltern und Großeltern tummeln. Da werden bestimmte Dinge einfach nicht gepostet. Grundsätzlich aber muss digitale Kommunikation mit der Familie nicht schlecht sein, früher haben wir einmal im Jahr mit der Oma telefoniert, heute schicken wir eben öfters Mal ein Hallo aufs Handy.
Statt bei Tisch oder am Telefon kommunizieren wir zunehmend über digitale Kanäle – und damit in einem semi-öffentlichen Raum.

Schülerin Paula Halder erklärt Snapchat - ein soziales Netzwerk, über das vornehmlich junge Menschen via Video miteinander kommunizieren.
Paula Halder erklärt Snapchat
Die Digitalisierung der Blaulichtwelt
Die Digitalisierung der Blaulichtwelt
- Von Ludger Möllers
Die Digitalisierung der Blaulichtwelt
Die Digitalisierung der Blaulichtwelt

Ein Szenario, das sich vor einigen Wochen bei der Herbstabschlussübung einer Feuerwehr in Baden abgespielt hat. „Im Ernstfall wäre es ernst geworden“, sagt eine Führungskraft, „an diesem Beispiel sehen wir die Grenzen der Digitalisierung, man ist total abhängig von den Tücken der Elektronik und kann nichts mehr selber reparieren.“ Denn eine mechanische Pumpensteuerung, wie sie jahrzehntelang in Feuerwehrautos eingebaut wurde, hätte nicht „von jetzt auf gleich“ versagt. Und jeder geschickte Feuerwehrmechaniker konnte die Steuerung instand setzen.
In die Blaulicht-Welt der Feuerwehren und der Rettungsdienste hat die Digitalisierung längst Einzug gehalten. Digitale Alarmierung, zentrale Displays mit Anweisungen auf den Wachen, Digitalfunk, Tablets mit allen wichtigen Informationen und die IT-Strukturen in den Leitstellen sind nur einige Beispiele.
Ein Blick in die Feuerwache Tuttlingen: „Wenn der Feuerwehrmann bei einem Alarm hereinkommt, sieht er sofort, was zu tun ist“, erklärt Stadtbrandmeister Klaus Vorwalder. „Auf dem Display steht, welches Fahrzeug benötigt wird, welches Fahrzeug eventuell schon ausgerückt ist, wo was passiert ist.“ Grüne, gelbe und rote Markierungen sind gesetzt, auf einem digitalen Stadtplan sind Baustellen und Staus markiert. Längst sind, von der Leitstelle gesteuert, die Rolltore geöffnet worden, in der Fahrzeughalle brennt Licht. Für den Einsatzleiter liegen die wichtigsten Informationen ausgedruckt auf Papier bereit. Im Löschfahrzeug finden die Einsatzkräfte digital gesteuertes Equipment vor: Wärmebildkameras, Explosionswarner, Navigationsgeräte, Defibrillatoren, Scheinwerfer. Über Displays werden Martinshorn und Blaulicht bedient. Vorwalder zeigt: „Die Drehleiter wird über einen Computer gesteuert, ähnlich wie die Löschwasserpumpe.“

Die Digitalisierung der Blaulichtwelt
Die Digitalisierung der Blaulichtwelt

„Natürlich muss man sich der Digitalisierung stellen“, sagt der Ulmer Kommandant Hansjörg Prinzing, „wir müssen die Vorteile nutzen und tun das.“ Für die staufreie Einsatzfahrt der traditionell innovativen Ulmer Wehr – in der Donaustadt ist mit der Firma Magirus einer der Weltmarktführer für Feuerwehrautos und Brandschutztechnik beheimatet – werden beispielsweise wartende Autos an ausgewählten Ampeln automatisch abgeleitet. Prinzing: „Aber wir sehen ganz klar die Grenzen und die Herausforderungen.“ Dass beispielsweise jeder elektronische Helfer im Einsatzfahrzeug ständig aufgeladen werden muss, wird wegen der Brandgefahr kritisch gesehen.
Weitaus relevanter: Feuerwehrbeamte seien schon heute in mindestens sechs Berufen ausgebildet und müssten sich fachlich und körperlich fit halten: „Sie bringen einen handwerklichen Beruf mit oder sind Ingenieur, dann haben sie eine feuerwehrtechnische Ausbildung, sind Rettungssanitäter, Lkw-Kraftfahrer, Kranwagen-Fahrer und Disponent auf der integrierten Rettungs- und Feuerwehrleitstelle.“ Hinzu kommen die steigenden Anforderungen an Elektronik und Digitalisierung: „Wir stoßen an Grenzen der menschlichen Aufnahmefähigkeit“, so Prinzing, „wir brauchen einfache Systeme, die der Feuerwehrmann auch unter Stress intuitiv verstehen und effektiv mit ihnen umgehen kann. Das sind, um zu vergleichen, gebürstete Versionen aus Stahl statt der vergoldeten Wasserhähne.“

Die Digitalisierung der Blaulichtwelt
Die Digitalisierung der Blaulichtwelt

Im Einsatz gebe es nur eine Chance, bei Übungen müsse der Ausfall der Elektronik thematisiert werden: „Dann ist es immer gut, wenn Kameraden die Bedienung ihrer Pumpen und Leitern per Hand noch immer beherrschen und der Einsatzleiter neben dem Tablet einen klassischen Ordner mit allen Unterlagen auf Papier bei sich hat“, sagt Klaus Vorwalder, „so ein Spickzettel, also eine Rückfallebene, beruhigt sehr!“

Lokaler Handel vs. E-Commerce: Kanal egal
Kanal egal
- Von Sigrid Stoss
Kanal egal
Kanal egal

Einen Ausweg aus der Misere sehen Experten und Ladeninhaber im sogenannten „Omnichannel-Commerce“. Das bedeutet soviel wie „Einkaufen über verschiedene Kanäle“ und meint die intelligente Vernetzung von online und offline aus einer Hand. Das kann beispielsweise so aussehen, dass der Kunde in seinem Modehaus im Internet einen Beratungstermin vor Ort buchen kann. „Gute Überlebenschancen haben diejenigen, die das beste aus beiden Welten kombinieren“, meint Christoph Langenberg, Projektleiter für den Forschungsbereich E-Commerce beim Handelsforschungsinstitut EHI in Köln.
Technisch noch nicht ausgereift
Viele Einzelhändler in unserer Region sind gerade dabei, hier Konzepte zu entwickeln. Der neu gewählte Präsident des baden-württembergischen Einzelhandelsverbandes, Hermann Hutter, will das Thema vorwärts bringen. Hutter betreibt neben einem Spieleverlag und Geschäften für den Bürobedarf auch die Abt-Lifestyle-Geschäfte in Ravensburg, Ulm und Günzburg, beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und verkauft auch im Internet. „Richtig durchgestartet sind wir vor zwei Jahren“, sagt Hutter im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Heute macht er gut ein Drittel seines Umsatzes – den er nicht nennen möchte – mit dem Online-Geschäft. In fünf Jahren soll es schon die Hälfte sein, und Hutter ist sich sicher: „Die Zukunft des Einzelhandels liegt in der Verknüpfung von online und offline“.
In der Praxis stellen sich allerdings einige technische Hürden in den Weg. Das beginnt beim Einrichten eines gut sortierten Online-Shops. Hutter weiß wovon er spricht. Von den über 100.000 Artikeln, die er in seinen Geschäften anbietet, sind rund 20.000 im Internet zu haben. „Jedes Produkt muss fotografiert und beschrieben werden. Das kostet viel Zeit und man braucht das Personal dafür“, so Hutter. Hinzu kommt die Sichtbarkeit im Internet, also die Suchmaschinen-Optimierung, denn wer über das Portal „Google shopping“ leicht zu finden ist, hat beim Kunden bessere Chancen – und das lässt sich Google bezahlen.

Kanal egal
Kanal egal

Doch Hutter ist überzeugt, dass es sich für den stationären Handel lohnt, in den eigenen Internet-Auftritt zu investieren. „Früher suchten sich Kunden ein bestimmtes Geschäft aus und schauten sich dort das Sortiment an“, erklärt der Geschäftsmann. Heute laufe es umgekehrt: „Viele Kunden informieren sich erst mal online über ein Produkt und sehen sich die Web-Seite des Ladens an.“ Ist der Eindruck im Netz vielversprechend, kommt der Kunde auch ins Geschäft, so das Kalkül. „Das Internet ist nicht nur Konkurrenz, es ist auch ein Zubringer“, betont Hutter. Und diesen Zubringer solle der Handel für sich nutzen.
Bei der Kombination von on- und offline gibt es mehrere Varianten. Rund jeder sechste Kunde nutzt bereits kanalübergeifende Angebote, so hat das Institut EHI aktuell erhoben. Besonders beliebt ist das „Click & Collect“: Artikel im Internet reservieren oder kaufen und dann das Buch oder die Blumenvase im Geschäft abholen. Beim Ravensburger Modehaus Bredl kann man ein Kleidungsstück online reservieren lassen und dann später im Laden anprobieren. Im Abt-Shop kauft und bezahlt der Kunde den Artikel im Netz und kann wählen, in welcher Filiale er diesen abholen möchte. Auch die Rückgabe ist im Ladengeschäft möglich.
Wünschenswert aus Kundensicht wäre laut EHI-Studie, die Möglichkeit auch direkt im Geschäft zahlen zu können, wenn man online bestellt hat. Außerdem würden viele Verbraucher gerne im Online-Shop erst mal nachschauen, ob der Artikel im Laden vorrätig ist. Das klappt allerdings häufig noch nicht. „Die größte Herausforderung für die Händler ist die Verknüpfung im Warenwirtschaftssystems“ erklärt Experte Langenberg. Viele Einzelhändler haben ihren Online-Shop bisher völlig getrennt vom Ladengeschäft geführt. Jetzt müssen sie beides vernetzen: „Wenn ein Produkt an der Ladenkasse verkauft wird, muss das im Online-Shop angezeigt werden“, so der EHI-Experte.

Kanal egal
Kanal egal

„In drei Jahren wird das im Einzelhandel Standard sein“, so ist der Werdich-Chef überzeugt. Der Kunde wolle heute nicht mehr auf die Bequemlichkeit des Internets verzichten. Das gelte quer durch alle Altersschichten. Das Kalkül, Kunden mit solchen Angeboten an die Ladengeschäfte zu binden, statt sie an pure Onlineanbieter zu verlieren, scheint aufzugehen: „Jeder zweite Online-Kunde wohnt im Umkreis von 30 Kilometern zu einer Filiale.
Einkaufen als Freizeitbeschäftigung
Den lokalen Handel stärken und gleichzeitig im Netz präsent sein ist auch aus Sicht von Michael Riethmüller kein Widerspruch. Der Inhaber der Buchhandlung „Ravensbuch“ hat 2012 die Initiative „Buy Local“ gegründet, um den inhabergeführte Einzelhandel in der Innenstadt zu stärken. Allein in Ravensburg haben sich dem Bündnis 26 Händler angeschlossen. Riethmüller betreibt in Ravensburg und Friedrichshafen Buchhandlungen und beschäftigt 38 Mitarbeiter. Bereits vor 15 Jahren begann er damit, seine Bücher auch online anzubieten und inzwischen können sich Besteller ihren Schmöker nach Hause liefern lassen, in der Buchhandlung abholen oder eine der Abholbox nutzen. Das Online-Geschäft sei der „verlängerte Arm“ sagt Riethmüller, es ersetze nicht den Buchladen als Ort der Begegnung.
Auch wenn das Omnichannel-Konzept tatsächlich greift, werden sich die Innenstädte verändern. Dass sie veröden ist allerdings unwahrscheinlich. Denn bei aller Liebe zum Internet entwickelt sich auch eine neue Lust am Shoppen: „Shopping ist heute für viele eine fester Bestandteil der Freizeitgestaltung“, sagt Ladeninhaber Hutter. EHI Experte Langenberg sieht einen „Trend zum Showrooming“: Geschäfte fingieren dann als Ausstellungsräume von schönen Waren - die dann per Smartphone bestellt werden.

Hermann Hutter, Präsident des Handelsverbands in Baden-Württemberg, analysiert das Verhältnis zwischen stationärem Handel und E-Commerce.
Kanal egal
Kann der Ärztemangel digital aufgefangen werden?
Kann der Ärztemangel digital aufgefangen werden?
- Von Barbara Waldvogel
Kann der Ärztemangel digital aufgefangen werden?
Kann der Ärztemangel digital aufgefangen werden?

Dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen noch eher zögerlich verläuft, hat gute Gründe: „Der Transfer von sensiblen Patientendaten muss hundertprozentig sicher sein“, erklärt Hausarzt Frank-Dieter Braun aus Biberach. Denn so viel ist klar: Ein möglicher unbefugter Zugriff von außen würde die Entwicklung um Jahre zurückwerfen. Wie der Betrieb im Büro des 2. Vorsitzenden des Hausärzteverbandes Baden-Württemberg genau aussieht, schildert er an einem Beispiel: Arztbriefe von Kollegen aus Kliniken oder Facharztpraxen landen bei ihm derzeit entweder als Fax, als Postbrief oder mitunter auch als handschriftliches Schreiben, das der Patient persönlich mitbringt. Das Fax läuft immerhin schon automatisch in die EDV ein, die anderen Briefe müssen jedes Mal von seinem Team extra eingescannt werden. Denn in Brauns Praxis gibt es nur noch elektronische Karteikarten. Er würde sich deshalb glücklich schätzen, wenn es mehr an digitaler Kommunikation gäbe. Zwar bietet die Kassenärztliche Vereinigung (KV) schon das Sichere Netz an. Das ist für den Hausarzt aber derzeit noch keine Alternative: „Ich bin noch nicht an das KV-SafeNet angeschlossen, weil derzeit nur die Kassenabrechnung übermittelt werden kann. Sobald es irgendeinen Zusatznutzen gibt, mache ich mit.“

Kann der Ärztemangel digital aufgefangen werden?
Kann der Ärztemangel digital aufgefangen werden?

Als erster wichtiger Schritt in diese Richtung wurde Mitte dieses Jahres gefeiert, dass die Überwachung von Patienten mit einem Defibrillator oder einer kardialen Resynchronisationstherapie (CRT-System) als erste telemedizinische Leistung in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) aufgenommen wurde. Damit können Fachärzte die Funktionsfähigkeit bestimmter kardiologischer Implantate auch telemedizinisch überprüfen und abrechnen. Herzschrittmacher zählen allerdings noch nicht dazu. Außerdem wurde am 1. Oktober 2016 der bundeseinheitliche Medikationsplan eingeführt. Das bedeutet: Wer mehr als drei verordnete Medikamente gleichzeitig braucht, hat jetzt einen Anspruch auf eine durch den Arzt erstellte Übersicht. Das E-Health-Gesetz sieht vor, dass der Medikationsplan ab 2018 auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden kann.
Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) dient derzeit lediglich als Nachweis für den Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse und wird vom Arzt oder Zahnarzt zur Abrechnung benötigt. Bereits heute schon sind darauf die Versichertenstammdaten gespeichert. Ändern sich diese, wird die Karte von der Krankenkasse ausgetauscht. Künftig sollen die Gültigkeit der Karte online geprüft und die Versichertenstammdaten direkt aktualisiert werden. Darüber hinaus wird der Chip auf der Karte einen verschlüsselten Container haben, auf dem medizinische Daten gespeichert werden können. Die elektronischen Gesundheitskarten der zweiten Generation sind von der Gesellschaft für Telematikanwendungen (gematik) bereits zugelassen und werden derzeit getestet.

Kann der Ärztemangel digital aufgefangen werden?
Kann der Ärztemangel digital aufgefangen werden?

Dass ein Teil der Bevölkerung den digitalen Neuerungen gegenüber durchaus aufgeschlossen ist, zeigt eine Analyse der Bertelsmann-Stiftung zur Video-Sprechstunde. Danach würden 45 Prozent der Bundesbürger öfter oder zumindest gelegentlich Video-Kontakt mit dem Haus- oder Facharzt aufnehmen. Für die Analyse wurde eine Umfrage unter fast 1600 Bundesbürgern im Sommer 2015, über 80 Literatur- und Studienquellen sowie Experteninterviews ausgewertet. Als häufigste Pro-Argumente erwähnten die Befragten: das Vermeiden langer Wartezeiten auf einen Arzttermin sowie die Angst vor Ansteckungen im Wartezimmer. Auch die Möglichkeit des Kontakts mit dem Arzt zu unüblichen Zeiten wurde hervorgehoben. Mit dem Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD) hat die Techniker Krankenkasse in Kooperation mit dem IT-Unternehmen Patientus ein bundesweites Projekt zur Erprobung von Online-Videosprechstunden gestartet.
Hautarzt Dirk Meyer-Rogge aus Karlsruhe hat vor einem halben Jahr solch eine Video-Sprechstunde eingerichtet. „Man kann den Fortschritt nicht aufhalten. Deshalb sollte man ihn auch mitgestalten. Es gibt außerhalb von Europa schon genügend schlechte Beispiele. Das wollen wir verhindern“, sagt er. Seine Erfahrungen sind bislang gemischt: So schrecken manche Patienten zurück, wenn sie für die Online-Behandlung zuerst zahlreiche Unterschriften leisten müssen. „Da kommen ihnen dann doch große Bedenken, was mit ihren Daten passiert.“ Das nächste Problem ist die technische Ausstattung. Benötigt werden entweder Notebook oder PC, ein Headset und eine kleine Kamera. „Jüngere haben aber meist gar keine PCs mehr. Sie sind fast nur noch mit dem Smartphone unterwegs“, sagt der Hautarzt. So können ausgerechnet die Digital Natives die virtuelle Sprechstunde gar nicht in Anspruch nehmen. „Außerdem sehe ich bei einer Online-Sprechstunde nicht alles, was ich im Sprechzimmer sehe. Deswegen arbeite ich virtuell vor allem mit Bestandspatienten. Die kenne ich, über diese habe ich viele Informationen.“ Dass sich die Dermatologen für das Modellvorhaben mit der TK erwärmen konnten, liegt laut Meyer-Rogge auf der Hand: „Es gibt wohl auch kein anderes Fach, wo man so viele Sachen visuell erkennen kann.“

Kann der Ärztemangel digital aufgefangen werden?
Kann der Ärztemangel digital aufgefangen werden?

Nun haben die Befragten bei der Bertelsmann-Studie auch zu erkennen gegeben, dass sie auf den direkten Arzt-Kontakt gar nicht verzichten wollen. Vor allem für die Erstdiagnose würden fast alle einen Arzt aufsuchen. So stellt sich immer mehr heraus, dass Video-Konsultationen vor allem gut geeignet wären für Rückfragen, Beratungen, Befundbesprechungen und das Einholen von Zweitmeinungen. Zudem könnten sie ein Instrument für die langfristige Begleitung chronisch kranker Patienten sein. Zudem könnten sie Vorteile bringen für unterversorgte ländliche Regionen. In der Analyse wird auch festgestellt, dass dafür die Berufsordnung gar nicht geändert werden müsste, sondern allenfalls an die modernen Herausforderungen angepasst.
Das Gesundheitswesen ist also zweifellos im Umbruch. Die Digitalisierung schreitet voran, nicht zuletzt auch, weil das Bundesgesundheitsministerium Druck macht. Bei der Verabschiedung des E-Health-Gesetzes erklärte Gesundheitsminister Hermann Gröhe mit Nachdruck: „Viel zu lang wurde schon gestritten. Deshalb machen wir Tempo durch klare gesetzliche Vorgaben, Fristen und Anreize, aber auch Sanktionen, wenn blockiert wird.“ Die Botschaft ist klar.

„Die Digitalisierung macht Arbeitsplätze sicherer“
- Von Ingrid Augustin
„Die Digitalisierung macht Arbeitsplätze sicherer“ Facharzt Dr. Hanns-Peter Knaebel über die Rolle der Digitalisierung in der Medizin
„Die Digitalisierung macht Arbeitsplätze sicherer“ Facharzt Dr. Hanns-Peter Knaebel über die Rolle der Digitalisierung in der Medizin

Das ist ein sehr weites Feld. Grundsätzlich spricht man von der sogenannten „computer assisted surgery“, also der computerunterstützten Chirurgie. Der Begriff zeigt bereits, dass es hier vor allem darum geht, dass die digitalen Helfer den Mediziner in seiner Arbeit unterstützen sollen – im OP wie auch bei anderen Behandlungsprozessen. Mit der optimierten Bereitstellung von Informationen soll er fundiertere Entscheidungen treffen können.
Im Operationssaal geschieht dies mithilfe zweier Angebote: Zuerst mit der digitalen Bereitstellung aller Informationen, die es zum Zeitpunkt der Operation über den Patienten gibt. Diese können auch völlig neu visualisiert werden. So kann der Operateur zukünftig beispielsweise bei einem Eingriff auf das endoskopische Bild auch noch die MRT- oder CT-Bilder projizieren. Damit ist es ihm möglich, präzisere Schnitte vorzunehmen.
Zudem soll dem Anwender durch direkt digital unterstützte Produkte geholfen werden, Handlungen auszuführen, die er so sonst nicht so einfach ausführen könnte. Beispielsweise kann eine digitale Übersetzung in endoskopischen Instrumenten ein Zittern herausfiltern. Andere Geräte vermögen beim Durchtrennen von Gewebe auch Strukturen, wie ein Blutgefäß zu erkennen und arbeiten dann nicht weiter.
Und was passiert dann?
Das entscheidet der Operateur. Der Mensch hat immer die Entscheidungshoheit. Wir wollen weniger Robotik im OP, denn damit wurden in der Vergangenheit nicht nur gute Erfahrungen gemacht - Stichwort Robodoc. Dieser war bei Hüftoperationen für den Fräsvorgang zuständig, hatte aber damals viel zu wenig Sensorik integriert. Deshalb merkte der Robodoc nicht, wenn Muskeln in den Fräsvorgang hineingezogen wurden oder wenn der Knochen so stark ausgehöhlt wurde, dass die Gefahr eines Knochenbruchs bestand. Durch seine selbstständigen Handlungen hat der Roboter mehr Probleme geschaffen, denn gelöst. Aus dieser Erfahrung haben wir gelernt, dass Digitalisierung in der Medizin bedeutet, nicht arztersetzend, sondern arztunterstützend zu arbeiten. Das bedeutet auch, dass keine Arbeitsplätze wegfallen, wie immer propagiert wird. Im Gegenteil, die Digitalisierung macht die Arbeitsplätze in der Medizin sicherer, effektiver und effizienter.

„Die Digitalisierung macht Arbeitsplätze sicherer“
„Die Digitalisierung macht Arbeitsplätze sicherer“

In allererster Linie gibt es natürlich wesentlich mehr Bildschirme und Informationsquellen in einem solchen OP, aber gleichzeitig dank modernen Verbindungstechnologien weniger Kabelsalat. Es sieht also viel aufgeräumter aus. Zudem findet man deutlich mehr zentrale Bedieneinheiten. Gerade in diesem Bereich wird sich die Medizintechnik noch weiter entwickeln.
Können Sie das genauer erläutern?
Bislang war es in der Medizin und -technik so, dass jeder nach seinen eigenen Standards gearbeitet hat. So konnte man zwar an einen Endoskopieturm auch andere Geräte anschließen, bedienen ließen sich diese aber nur mit einer separaten Einheit. Das ist in etwa vergleichbar mit Windows und iOS: Früher nutzte man entweder das eine oder das andere Betriebssystem und deren Programme. Heute ist es aber möglich, auch auf einem Apple-Gerät ein Windows-Paket zu installieren. In vielen Operationssälen ist es heute noch so, dass die Geräte nicht untereinander kommunizieren können. Daran müssen wir arbeiten.
Ist digitale Chirurgie besser, im Sinne von weniger fehlerbehaftet?
Zwei Punkte sind hier meiner Meinung nach relevant. Zum ersten: Wir arbeiten alle an einem großen Ziel, nämlich die Erhöhung der Patientensicherheit. Der Weg dorthin ist aber nicht immer der direkte. Das heißt, wir legen unseren Fokus nicht ausschließlich auf den Patienten, sondern auch auf den Gesamtprozess. Wir versuchen die Prozesse für den Operateur einfacher oder auch angenehmer zu machen - wie mit dem vorhin erwähnten Beispiel, dass er sich CT-Aufnahmen auf seine Ansicht projizieren lassen kann. Das führt zu dem indirekten Effekt, dass der Patient weniger gesundes Gewebe verliert und „gesünder“ aus der Operation kommt.
Gleichzeitig ist es ein Komfortgewinn für den Chirurgen, wenn er schneller und einfacher erkennt, wie er als nächstes vorgehen muss. Die raschere Entscheidungsfindung strengt ihn weniger an – er ist leistungsfähiger. Das kann alles dazu beitragen, dass er weniger Fehler macht.

„Die Digitalisierung macht Arbeitsplätze sicherer“
„Die Digitalisierung macht Arbeitsplätze sicherer“

Ein zentraler Aspekt. Insbesondere bei der sogenannten Lernkurve spielt die digitale Chirurgie eine wichtige Rolle. Damit wird die Anzahl der Eingriffe bezeichnet, die ein junger Arzt benötigt, um eine Operation sicher durchführen zu können. Verständlicherweise will man diese Lernkurve nicht mehr am Patienten durchführen. Auch gegen unnötige Operationen im Tierversuch gibt es ethische Bedenken.
Nun haben wir gemeinsam mit einem Unternehmen einen OP-Simulator entwickelt, der den Jungmedizinern nicht nur die Arbeit an der Konsole vermittelt, sondern auch ein haptisches Feedback gibt. Wenn diese bei dem Übungseingriff gegen ein anderes Organ stoßen, erfahren sie tatsächlich den Widerstand, der dem Organ auch in der Realität entspricht. Sie erhalten so die Möglichkeit den Umgang mit dem Gewebe zu erlernen, ein Gespür dafür zu entwickeln. Das geht aber nur mit der modernen Sensorik.
Zudem wird momentan sehr aktiv am kontinuierlichen Abgleich von Informationen gegen die vorhandenen Datenmengen gearbeitet.
Ein Beispiel?
Heute passiert sehr viel in der molekularen Diagnostik. Dabei wird versucht, Krankheiten wie auch Tumore genetisch genauer zu analysieren. Wenn ein Arzt nun eine solche Mutation findet, dann muss er sich entscheiden, ob diese einen Krankheitswert hat oder möglicherweise gar nicht relevant für eine Therapieentscheidung ist. Dazu benötigt er nicht nur eine gut gepflegte Datenbank im eigenen Krankenhaus, sondern muss auch auf andere Datensammlungen zugreifen können, in denen er nach ganz spezifischen Mutationen suchen kann. Solche Datensammlungen gibt es beispielsweise im DKFZ in Heidelberg - es gibt aber noch weitere Datenbanken für andere Krankheitsbilder.
Entscheidend aber ist, dass die Informationen schneller, einfacher und auch leichter vergleichbar zugänglich gemacht werden müssen.

„Die Digitalisierung macht Arbeitsplätze sicherer“
„Die Digitalisierung macht Arbeitsplätze sicherer“

Heilung ist ein großes Wort. Ich möchte einen Schritt zurückgehen. Bleiben wir einmal bei einer Tumorerkrankung. Bisher gibt es für bestimmte Tumorarten bestimmte Therapiekonzepte bzw. -schemata. Wenn man also einen Dickdarmtumor operiert und den Befund aus der Pathologie zurückerhält, kann man den Patienten einem Therapieschema zuordnen, in dem die Art der Medikamente und der Behandlungen vorgeschrieben ist. Die einzige Variable darin ist das Körpergewicht des Patienten, das die Dosis bestimmt.
Nun kann man den Tumor genetisch analysieren lassen, ob er bestimmte Eigenschaften besitzt. Sollte sich bei einem Abgleich in einer Tumordatenbank herausstellen, dass dieser Dickdarmtumor die Eigenschaften eines Nierentumor hat, kann etwas Erstaunliches passieren. Der Arzt kann sich jetzt nämlich gegen das ursprüngliche Schema und sich für eine andere Therapie entscheiden. Mit dieser „targeted therapy“ (gezielte Therapie) kann der Tumor wesentlich spezifischer behandeln werden. Das erhöht die Heilungschancen des Patienten, weil weniger Therapieversuche benötigt werden.
Dies ist eine Form der personalisierten Therapie, wobei natürlich klar sein muss, dass wir nicht für jeden Patienten eine Therapie völlig neu erfinden können. Es gilt ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Standardisierung und der Individualisierung. Denn die Medizin benötigt die Erfahrungswerte der erprobten Therapiestandards ebenso wie die richtige Zuordnung des Patienten zu den vorhandenen Therapieoptionen. Und wir sind hier auf einem sehr guten Weg.
Ist digitale Chirurgie ein Mittel gegen den Ärztemangel?
Sie kann ein Mittel dagegen sein – auch wenn das, was ich gleich sagen werde, zunächst wie ein Widerspruch klingt. Denn alles, was wir heute in der Medizintechnik entwickeln, strebt danach den Kontakt zwischen Arzt und Patient zu reduzieren. Der Grund dafür ist einfach: Der Patient will mehr Freiheit haben. Er will trotz Erkrankung mobil sein und bleiben – und nicht alle fünf Tage zum Arzt fahren, um das Ventil seines Shunts überprüfen oder neu einstellen zu lassen. Er will das selber machen können und über eine App steuern. Gleichzeitig kann der Arzt jederzeit die Werte einsehen und ihn beraten.
Unser Ziel ist es, durch sofortige Verfügbarkeitmachung von Informationen, durch eine einfachere Dokumentation und Übermittlung von Daten, den Mediziner von den sogenannten arztfremden Tätigkeiten entlasten. Damit erhalten sie mehr Freiräume für die echte ärztliche Tätigkeit. Das wiederrum macht den Arzt produktiver, was bedeutet, dass er in gleicher Zeit mehr Patienten betreuen kann.
Im Moment hakt es allerdings an der noch unterschiedlichen digitalen Reife der Ärzte selbst sowie ihrer Systeme. So gibt es immer noch Praxen, die kaum E-Mails versenden, dafür aber Faxe. Das ist im Moment noch das größte Problem. Doch schon mit der nächsten, digital aufgewachsenen Medizinergeneration, wird sich dies ändern und wir werden einen Riesenschritt vorwärts gehen.
Werden Roboter je selbstständig Menschen operieren?
Ich sehe das in den nächsten zehn Jahren nicht - eben weil all unsere Bestrebungen darauf abzielen, die Handlungshoheit beim Arzt zu belassen. Möglicherweise werden in 10 bis 30 Jahren Roboter für bestimmte, standardisierte Eingriffe eingesetzt werden. Allerdings bedarf es hierfür modernere, lernfähige Computersysteme, denen man diese Operationen in all ihren Varianten beibringen muss.

3-D-Drucker: Die Fabrik der Zukunft
3-D-Drucker: Die Fabrik der Zukunft
- Von Simon Haas
3-D-Drucker: Die Fabrik der Zukunft
3-D-Drucker: Die Fabrik der Zukunft

Ganz anders im Jahr 2364. „Tee, Earl Grey, heiß“, ein kurzes Piepen – fertig. In der Science-Fiction-Serie „Star Trek“ hat der 3-D-Drucker der Zukunft längst Serienreife. Einmal programmiert erzeugt der „Replikator“ Jean-Luc Picards Lieblingstee scheinbar aus dem Nichts. Netter Nebeneffekt: Mit der neuen Technologie haben sich auch die Produktionsverhältnisse ein Stück weit verändert. Mit dem „Replikator“ können Waren dort hergestellt werden, wo sie gebraucht werden: im Wohnzimmer, im Büro, in der Werkstatt.

3-D-Drucker: Die Fabrik der Zukunft
3-D-Drucker: Die Fabrik der Zukunft

Trotz der rosigen Zukunft, die die Marktforscher den 3-D-Druckern prophezeien, lohnt sich die Anschaffung noch nicht für jeden, glaubt Mikrotechnik-Professor Tim Lüth: „Wer sich für Technik interessiert, eine Lego- oder Fischertechnik-Sammlung ergänzen will oder eine Werkstatt im Haus hat, schreinert, bastelt – dem würde ich durchaus dazu raten einen Drucker anzuschaffen.“ Zusammen mit seinem Team von der TU München forscht Lüth an dem neuen Fertigungsverfahren und stellt unter anderem winzige Roboter für die Chirurgie her. Auch in der Medizintechnik ist der 3-D-Druck auf dem Vormarsch, bereits heute werden viele künstliche Gelenke und Prothesen ausgedruckt, künftig sollen sich sogar Herzklappen und Ersatz-Organe auf Knopfdruck herstellen lassen. „Eine Revolution findet definitiv statt, aber die Veränderungen sind für viele noch nicht nachvollziehbar“, glaubt Lüth.
Auch die Hersteller von 3-D-Druckern selbst sind nur vorsichtig optimistisch: „Dass jeder zum Produzenten wird und künftig alles bei sich zu Hause druckt, glaube ich nicht“, sagt die Geschäftsführerin von Multec, Petra Rapp. Zusammen mit ihrem Mann Manuel Tosché hat sie in Riedhausen im Kreis Ravensburg mehrere 3-D-Drucker entwickelt. Mit dem geeigneten Druckkopf (“Extruder“) und dem passenden Füllmaterial lassen sich in ihren „Multirap“-Maschinen sogar Lebensmittel modellieren. Knapp 1000 Drucker hat das Unternehmen bereits verkauft, der Umsatz liegt Rapp zufolge inzwischen im einstelligen Millionenbereich. „Eher werden sich lokale 3-D-Druck-Dienstleister durchsetzen, bei denen Endverbraucher dann ihre Modelle drucken lassen können“, glaubt Rapp. Größere Umwälzungen sieht sie vor allem im Bereich der industriellen Produktion. „Ersatzteile zum Beispiel muss man ja nicht zigtausendfach im Spritzgussverfahren in China fertigen lassen. Diese könnte eine Werkstatt schon bald selbst drucken – lokal und termingerecht.“

Was können 3D-Drucker unter 2000 Euro? Wir haben uns bei der Firma Multec in Riedhausen (Kreis Ravensburg) günstige Drucker für den Heimgebrauch angeschaut.
3-D-Drucker: Die Fabrik der Zukunft
3-D-Drucker: Die Fabrik der Zukunft

Marvin zum Beispiel. Nachdem Jürg Maier ihm das passende Kommando gegeben hat, streckt Marvin die Hand aus, neigt den Kopf in Richtung seines Gesprächspartners und sagt mit monotoner Stimme: „Ich bin glücklich, einem Menschen die Hand geben zu können.“ Marvin ist ein lebensgroßer humanoider Roboter und der Grund, warum sich der Schweizer Jürg Maier bei der Firma Multec einen 3-D-Drucker gekauft hat. „Als ich das Roboter-Projekt des französischen Designers Gael Langevin gesehen hab, war mir klar: Den will ich haben“, erzählt Maier. Der Franzose hatte die Baupläne des Roboters frei verfügbar ins Internet gestellt; Maier musste sie nur noch ausdrucken. Jede Schraube, jedes Zahnrad in Marvin stammt aus Maiers Multec-Drucker, der kaum größer ist als eine Kaffeemaschine. Mithilfe von 29 Motoren kann Marvin jetzt seine Arme und seinen Kopf bewegen, außerdem reagiert er auf Sprachbefehle und merkt sich dank Kamera und Mikrofon Gesichter und Namen. „Der 3-D-Druck macht ja nur einen Teil der Produktion aus. Anschließend muss man die Einzelteile zusammenbauen und verkabeln – auch reparieren muss man den Roboter immer wieder“, erklärt Maier.
Für den Laien kaum machbar. Hinzu kommt, dass sich mit den günstigen Druckern für den Heimgebrauch noch keine Metalle verarbeiten oder diese gar mit Kunststoff kombinieren lassen. Auch die Druck-Qualität ist bei sogenannten Filament-Druckern zwischen 200 und 2000 Euro immer noch recht mäßig; komplexe Ausdrucke gelingen oft nicht auf Anhieb. Und bis die Düse, eine Art Heißklebepistole, den verflüssigten Plastikdraht (Filament) Schicht für Schicht aufgetragen hat, vergehen selbst bei einer Handyhülle mehrere Stunden. Größere Objekte wie Roboter Marvin müssen von Hand zusammengeklebt oder -gesteckt werden.
Muss die Revolution in den Privathaushalten also nachsitzen? Mikrotechnik-Professor Tim Lüth ist dennoch davon überzeugt, dass sich die Technologie langfristig durchsetzen wird – auch in den Wohnzimmern: „In 50 Jahren hat jeder einen 3-D-Drucker zu Hause.“

Um externe Dienste auszuschalten, hier Einstellungen ändern.
Die Top Ten der beliebtesten 3-D-DruckerAllgemein gilt: Je genauer die Drucktechnik, desto höher die Kosten. Ein Profi-Gerät kann deshalb auch eine halbe Million Euro kosten.
Voraussetzung für den 3D-Druck ist eine Computersoftware. Diese zerlegt ein digitales Modell in Schichten und schickt die Anweisungen an den Drucker. Diese Schichten ergeben übereinander gelegt das dreidimensionale Modell. Der Bauraum bestimmt dabei, wie groß ein Objekt werden kann - so wie viele herkömmliche Drucker nur im Standard-Format A4 drucken können.
Neben Kunststoff lassen sich auch Objekte aus Gips drucken. Dabei werden Pulverschichten übereinander angeordnet und dann mit einem Bindemittel verfestigt. Für industrielle Zwecke hat sich unter anderem das sogenannte Laser-Sinter-Verfahren durchgesetzt, bei dem ein Laser einzelne Kunststoff- oder Metallpartikel miteinander verschmilzt. Anschließend können die Objekte direkt verwendet oder durch Schleifen und Lackieren veredelt werden.
So schützen Sie sich vor Datendieben
So schützen Sie sich vor Datendieben
- Von Katharina Dodel
So schützen Sie sich vor Datendieben
So schützen Sie sich vor Datendieben

Während im Jahr noch 310 Fälle von Internetbetrug im Landkreis Neu-Ulm und dem nördlichen Landkreis Günzburg bei der Neu-Ulmer Kripo eingegangen sind, waren es 2015 schon 400 und in diesem Jahr sind es bereits 450 Fälle. „Der Trend geht weiter in diese Richtung“, sagt Mayer, der die „Cybercrime“-Abteilung leitet. Diese gibt es seit Mai 2014. Drei Ermittler und eine Halbtageskraft arbeiten dort, ein weiterer Polizist absolviert derzeit ein berufsbegleitendes Studium in IT-Forensik und Cybercrime an der Hochschule Mittweida.
Die sogenannten Cybercops sind derzeit gefragt wie nie. Die Fälle häufen sich, weil „immer mehr Leute das Internet nutzen – auch ältere Menschen bestellen heutzutage über Smartphone, Tablet oder den PC Sachen oder machen Bankgeschäfte“, sagt Kriminalhauptkommissar Mayer.
Ein Beispiel ist Rolf B. – 76-Jähriger Neu-Ulmer, dem im September plötzlich 163,19 Euro auf seinem Konto fehlten. Ein Betrüger hat B.s Daten im Netz abgefangen und munter damit eingekauft. Das sei nur eine von vielen möglichen Maschen, sagt Mayer. Entweder Betrüger fangen die Kreditkartendaten im Internet ab und kaufen mit diesen gleich selbst ein, oder sie verkaufen die Daten von Menschen wie Rolf B. im Darknet (einer Art Internet-Parallelwelt für Kriminelle).
Eine neue Masche ist laut Mayer auch der „Waren-Agent“. Ein gutgläubiger Bürger werde von einer Firma angeworben und angewiesen, Pakete anzunehmen, umzupacken und neu zu verschicken. „Die Betroffenen glauben dann, für ein legitimes Unternehmen zu arbeiten“, sagt Mayer. In Wahrheit sei es eine Art Geldwäsche, oder Verschleierungstaktik. Denn so sei den echten Übeltätern nur schwer auf die Schliche zu kommen.Noch dreister und „momentan sehr oft benutzt“ sei eine weitere Art des Betrugs: Ein Geschäftspartner bestellt beispielsweise Waren und schickt die nötigen Daten an den Kollegen. Da schaltet sich ein Hacker dazwischen und verändert die Kontodaten in der Mail – meist seien diese Veränderungen so geschickt, dass der Empfänger sie nicht bemerkt und das Geld an das falsche Konto überweist.

So schützen Sie sich vor Datendieben
So schützen Sie sich vor Datendieben

Noch dreister und „momentan sehr oft benutzt“ sei eine weitere Art des Betrugs: Ein Geschäftspartner bestellt beispielsweise Waren und schickt die nötigen Daten an den Kollegen. Da schaltet sich ein Hacker dazwischen und verändert die Kontodaten in der Mail – meist seien diese Veränderungen so geschickt, dass der Empfänger sie nicht bemerkt und das Geld an das falsche Konto überweist.
Die auffälligste und dennoch offenbar eine effektive Masche ist der sogenannte Verschlüsselungs-Trojaner. Hacker legen mit diesem die Software ganzer Firmen lahm. Dann erfolge meist eine Zahlungs-Aufforderung – wird dieser Folge geleistet, versprechen die Betrüger, das System freizugeben. „Oft bezahlen die Unternehmen die Summe, damit sie keine weiteren Verluste einfahren“, sagt Mayer.

So schützen Sie sich vor Datendieben
So schützen Sie sich vor Datendieben

Mayer rät allen Bürgern, sich schon vorab vor Betrügerangriffen zu schützen. „Ein gesundes Misstrauen ist wichtig“, sagt er. „Am besten keine Links anklicken“, so der Cybercop. Er empfiehlt, sich lieber im Account direkt auf der Internetseite anzumelden – beispielsweise beim Online-Versandhandel.
Ist der PC einmal von Betrügern durchleuchtet worden, hat Mayer nur eine Empfehlung: „Das Gerät sofort plattmachen lassen.“ Anschließend die Passwörter ändern – er verrät auch wie: „Niemals für mehrere Accounts die gleichen verwenden“, appelliert Mayer. Er rät zu verschiedenen Passwortphrasen – beispielsweise: „Ichkaufebeimversandhandel“. Einmal im Jahr sollte jedes Passwort geändert werden, sagt er, auch wenn er weiß, dass das in der Praxis für viele zu mühsam ist. „Bequemlichkeit und Sicherheit sind Feinde“, sagt der Neu-Ulmer Kriminalhauptkommissar. „Also lieber schnell das Passwort ändern.“

Digitaler Wandel durch Tablets an Schulen
Digitaler Wandel durch Tablets an Schulen
- Von Kara Ballarin
Digitaler Wandel durch Tablets an Schulen
Digitaler Wandel durch Tablets an Schulen

Bei einem Kongress des Landesmedienzentrums (LMZ) in Stuttgart zum Lehren und Lernen im digitalen Zeitalter beschrieb Eickelmann die Digitalisierung jüngst als fundamentalen Wandel. „Baden-Württemberg geht mit gutem Beispiel voran.“ Die Verankerung der Leitperspektive Medienbildung in den neuen Bildungsplänen, nach denen seit diesem Schuljahr unterrichtet wird, böte gute Ansätze. Das scheint nötig, denn Baden-Württemberg hinkt hinterher.
Eickelmann war an zwei Studien zum Zustand der digitalen Bildung an Schulen beteiligt. In der „International Computer and Information Literacy Study“ (ICILS) von 2013 wurden die Kenntnisse von Zwölf- bis 13-Jährigen in 24 Staaten verglichen. Deutschland erreichte nur das Mittelfeld. Eine Erkenntnis daraus: Fast 30 Prozent der deutschen Jugendlichen werden mit ihren Computer-Kenntnissen in die beiden unteren Kompetenzstufen eingruppiert. Die Leistungsspitze erklommen lediglich 1,5 Prozent. Dass Deutschland in dieser Studie das Schlusslicht bei der Nutzung neuer Technologien durch Lehrer bildete, schreckte auf.
Ein noch detaillierteres Bild lieferte die Studie „Schule digital“ von 2015, an deren Erhebung Eickelmann ebenfalls beteiligt war. Die Untersuchung brachte erstmals Erkenntnisse dazu, wie unterschiedlich die Bundesländer den Weg der digitalen Bildung beschreiten. „Jetzt wird es kritisch für Baden-Württemberg“, so Eickelmann. In etlichen Bereichen rangierte der Südwesten im Ländervergleich im unteren Drittel – etwa bei der Frage, ob Lehrer glauben, dass Schüler dank Computer besseren Zugang zu Informationsquellen bekommen. Zwei Drittel der befragten Lehrer gaben an, dass es an ihrer Schule kein Medienkonzept gebe. Lediglich ein Drittel der Schulleiter gaben dem Einsatz von Computern im Fachunterricht eine hohe Priorität. „Dabei geht es nicht um Technik, sondern um Pädagogik“, erklärt Eickelmann.

Digitaler Wandel durch Tablets an Schulen
Digitaler Wandel durch Tablets an Schulen

Grundlegendes Medienwissen ist mittlerweile fester Bestandteil der Lehrerausbildung – an den Hochschulen wie auch in den Seminaren. Die künftigen Lehrer lernen darin, wie sie mit digitalen Medien umgehen können und wie sie diesen Umgang ihren Schülern vermitteln. Diejenigen, die bereits im Schuldienst sind, werden geschult. Allein während des vergangenen Schuljahres haben knapp 11 000 Lehrer an Fortbildungen im Bereich Digitalisierung teilgenommen. Dabei geht es, neben dem Umgang mit der Technik, vor allem um Inhalte, denn „Medieneinsatz ist kein Selbstzweck“, wie Kultus-Staatssekretär Volker Schebesta (CDU) jüngst beim LMZ-Kongress erklärte. In Fortbildungen lernen die Lehrer auch, wie sie den „Basiskurs Medienbildung“ unterrichten können – dieser ist mit Einführung der neuen Bildungspläne seit diesem Schuljahr für alle Fünftklässler verpflichtend.

Digitaler Wandel durch Tablets an Schulen
Digitaler Wandel durch Tablets an Schulen

Welchen Mehrwert der Tablet-Einsatz haben kann, beweist ein Blick nach Freiburg. Der Physik-Leistungskurs des Friedrich-Gymnasiums hat in einem Projekt mit der dortigen Pädagogischen Hochschule ein Jahr lang den Einsatz von Smartphones und Tablets getestet. Die Sensoren, die in den Geräten eingebaut sind, nutzten die Schüler für Experimente. Das Projekt war solch ein Erfolg, dass die beteiligten Lehrer den Deutschen Lehrerpreis 2016 in der Kategorie „Unterricht innovativ“ verliehen bekamen. Nun baut die Schule den Einsatz digitaler Endgeräte aus: Das Gebäude wird mit Wlan ausgestattet, digitale Medien halten Einzug ins Klassenzimmer, alle Lehrer sollen Tablets erhalten – und ab kommendem Schuljahr auch alle Neuntklässler.Diese Schule ist ein Leuchtturm von vielen. Eine flächendeckende Digitalisierung in den Klassenzimmern braucht hingegen noch Zeit.

Expertin warnt vor der IT-Industrie Amerikas
Expertin warnt vor der IT-Industrie Amerikas
- Von Benjamin Wagener
Expertin warnt vor der IT-Industrie Amerikas
Expertin warnt vor der IT-Industrie Amerikas

Wir unterscheiden zwischen starker und schwacher künstlicher Intelligenz. Die schwache künstliche Intelligenz läuft schon heute in Suchmaschinen, bei der Bild- und Texterkennung bei Übersetzungsprogrammen. Starke künstliche Intelligenz ist mehr, sie hat eine Art Bewusstsein – zum Beispiel die Intention, ein Ziel zu erreichen.
Und damit agieren diese Maschinen autonom?
Die Ziele einer künstlichen Intelligenz werden als mathematische Nutzenfunktion ausgedrückt, und diese wird immer weiter optimiert. Damit das möglich ist, überwachen die Maschinen die Umwelt, in die sie hineingesetzt werden, analysieren die erfassten Messdaten – Big Data –, fusionieren sie zu einem Lagebild und treffen aufgrund der neu gewonnenen Lageinformation eigene Entscheidungen, mit denen sie wiederum in die Umwelt eingreifen. Wir bezeichnen das als geschlossenen Regelkreis.
Wo wird das eingesetzt?
Bei der Steuerung von Industrieanlagen, auf den Finanzmärkten und auch in Suchmaschinen. Im Grunde ist die Google-Suchmaschine ebenfalls ein geschlossener Regelkreis. Und natürlich kann man auch die ganze Gesellschaft als System begreifen, die ich wie eine Industrieanlage steuere und regele. Das Silicon Valley arbeitet an Projekten, um mit Technologie steuernd in Gesellschaften einzugreifen.
Wie soll das funktionieren?
Es geschieht ganz beiläufig durch das Internet der Dinge. Dafür vernetzen wir unseren kompletten Alltag. Alle Geräte, die wir nutzen, sollen eine IP-Adresse bekommen: der Stromzähler, der Feuermelder, der Regenschirm, der ICE-Sitz, das TV, die Armbanduhr ... Wir verwandeln die Dinge unseres Alltags in Messgeräte, die Daten sammeln und senden. Künstliche Intelligenzen bei den Herstellern analysieren unsere Datenspuren, die wir überall, wo wir uns bewegen, wo wir surfen, hinterlassen, und erstellen Profile von uns.

Expertin warnt vor der IT-Industrie Amerikas
Expertin warnt vor der IT-Industrie Amerikas

Der Sinn des Internets der Dinge ist doch, dass wir gesünder, moralischer, effizienter leben – eben optimiert. Dazu erschaffen wir uns Maschinen, die uns immer einen Schritt voraus sind, weil sie unsere Daten haben und daraus berechnen können, was wir als Nächstes wollen, denken oder tun. Wir nennen das Umgebungsintelligenz. Aber sie schränkt unsere Grundrechte in einem großen Maße ein.
An was denken Sie?
Umgebungsintelligenz führt in die Totalüberwachung. Je mehr Umgebungsintelligenz wir schaffen, desto weniger Rückzugsräume haben wir. Nicht einmal im Schlafzimmer sind wir dann noch allein: Dort steht mein intelligent vernetzter Wecker, da liegt meine Armbanduhr, die meine Gesundheitsdaten misst, und meine vernetzte Bettdecke, die mein Schlafverhalten überprüft.
Warum ist das gefährlich?
Weil Sie sich nie mehr so geben können, wie Sie eigentlich sind, weil Sie andauernd das Gefühl haben müssen, beobachtet, vermessen, gescannt und kontrolliert zu werden. Man hat immer einen unsichtbaren Beobachter hinter, neben, über sich. In der Öffentlichkeit stellt sich jeder so dar, wie er gerne gesehen werden will. Jeder möchte ja anders wahrgenommen werden, als er ist. Keiner will ja zum Beispiel, dass andere sehen, dass man schlechte Essgewohnheiten hat. Doch plötzlich ist alles öffentlich.
Was bedeutet das für die Demokratie?
Es kann sich keine pluralistische Gesellschaft entwickeln. Pluralismus entsteht nur, wenn sich Individuen in aller Freiheit entfalten können. Stattdessen sind wir auf dem Weg in die konforme Gesellschaft – und die widerspricht dem Gedanken der Demokratie. Denn in der Demokratie muss es immer auch Minderheiten geben, die nicht konform sind. Und diese Minderheiten müssen die Möglichkeit haben, zur Mehrheit zu werden.

Expertin warnt vor der IT-Industrie Amerikas
Expertin warnt vor der IT-Industrie Amerikas

Die Umgebungsintelligenz einer hochvernetzten Gesellschaft erstellt kontinuierlich Persönlichkeitsprofile und Verhaltensprognosen. Die Vision: Wer sich verhält wie erwartet, bekommt einen Bonus, wer nicht, einen Malus. Das schließt quasi aus, dass sich ein Mensch widerständig verhält. „People Score“ nennen wir das, die chinesische Regierung hat Anfang 2016 mit dem Scoring ihrer Bürger begonnen. Technisch ist das Scoring längst auch bei uns im Westen möglich – und wird auch praktiziert. Alltägliches Beispiel: der Kredit-Score einer Person, berechnet auf der Basis von Facebook-Freundschaften. Nur wer genug Akademiker-Freunde hat, bekommt einen Kredit oder eine andere Leistung: eine Versicherung, den Führerschein, einen Operationstermin.
Das erscheint mir eine düstere, unrealistische Zukunftsvision.
Das ist sehr realistisch – und sehr gefährlich. Allein durch die Likes, die wir auf Facebook setzen, können Computer berechnen, ob man alkoholabhängig, depressiv oder schwanger ist. Dazu muss man kein einziges Wort gepostet haben. Wenn Sie zum Beispiel männlich sind und Britney Spears liken, ist das eine Indikation, dass Sie homosexuell sind. Die Maschinen treffen eine Aussage über Ihren Charakter, und wenn Menschen das wissen, verhalten sie sich anders.
Aber setzt nicht gerade eine Gegenbewegung ein? Wehren sich die Menschen nicht gegen diese Art des Datenmissbrauchs?
Das stimmt, aber es nützt uns nicht mehr viel. Denn die Datenerfassung erfolgt zunehmend nicht-kooperativ, also ohne unser Wissen. Das Google-Abacus-Projekt etwa verfolgt das Ziel, Nutzerverhalten ständig zu prüfen, um herauszufinden, ob der Anwender wirklich der ist, für den er sich ausgibt. Dazu gehört auch, die Bewegung von Menschen zu überwachen: wie ein Mensch auf der Tastatur tippt oder wie er läuft. Der Gang eines Menschen ist einzigartig. Das heißt: Wenn wir in Zukunft durch eine Straße laufen, in der smarte Kameras installiert sind, könnten uns Maschinen identifizieren.
Wer treibt das voran?
Das sind die amerikanischen Internetgiganten im Silicon Valley – alle unsere Lieblingsmarken von Google bis Facebook. Sie bauen mit ihrem Kapital ihren Technologievorsprung immer weiter aus und haben längst begonnen, die Gesellschaft an der Politik vorbei zu gestalten. Das ist alles nicht demokratisch beschlossen, aber wir legitimieren es soziologisch, einfach indem wir mitmachen und Facebook, Google, WhatsApp nutzen.

Expertin warnt vor der IT-Industrie Amerikas
Expertin warnt vor der IT-Industrie Amerikas

Das ist ein riesiges Geschäft, die werden gehandelt. Acxiom ist zum Beispiel einer der größten Datenhändler der Welt. Auf den Servern in den USA liegen 44Millionen deutsche Dossiers – und keiner weiß, was in seinem Dossier steht. Ich weiß das von meinem Dossier jedenfalls nicht.Wie sieht so eine Akte aus?Eine solche Akte enthält Merkmale über eine Person, bis hin zum Klarnamen. Zum Beispiel könnte da stehen: Yvonne Hofstetter, sexuelle Orientierung 1: weiblich, sexuelle Orientierung 2: ledig, sexuelle Orientierung 3: schläft gerne mit jungen Männern.
Wer kauft solche Profile?
Unternehmen, die ihre Kunden besser kennenlernen wollen. Oder neue Kunden gewinnen wollen. Beratungsunternehmen. IT-Serviceanbieter. Streaming-Dienste, die ihre Kunden nur noch mit den Filmen oder der Musik beglücken wollen, die ihre Kunden mögen. Daten sind teuer, der Kaufpreis kann in die Millionen gehen.
Bemerken das die Kunden nicht?
Die Personalisierung von Angeboten schränkt die Diversität ein. Das Nutzererlebnis wird eindimensionaler, flacher. Nutzer beginnen, in einer Blase zu leben, sie bekommen nur noch die Informationen und Inhalte, die ihren vermeintlichen Interessen entsprechen. Deshalb ist der IS auch zum Teil ein Internet- und Jugendphänomen: Wer sich zu einem bestimmten Thema in einem sozialen Netzwerk bewegt, bekommt viele Informationen angezeigt. Irgendwann glaubt so ein junger Mensch, die ganze Welt bestünde nur aus den Ideen des IS.
Was ist, wenn die erstellten persönlichen Profile falsch sind?
Das ist eine große Gefahr. Keiner weiß, welche Algorithmen Profile erstellen, aufgrund von welchen Daten, ob diese Rohdaten richtig oder falsch sind. Für den Einzelnen ist der Vorgang völlig intransparent. Er weiß nicht mehr, was vorgeht, und deshalb kann er Fehler auch nicht einklagen. Was ist zum Beispiel, wenn die algorithmisch berechnete Information über ein vermeintliches Krebsrisiko bei der Krankenversicherung des betroffenen Nutzers landet? Aber das ist alles kein technologisches Problem, das ist ein Problem des Marktes, weil Wirtschaftsakteure diese Entwicklung vorantreiben, um Geld zu verdienen.

Expertin warnt vor der IT-Industrie Amerikas
Expertin warnt vor der IT-Industrie Amerikas

Weil die Digitalisierung schön verpackt als Lifestyle daherkommt. Jeder will dabei sein, jeder will mitmachen, und keiner will außen vor sein. Mir ist manchmal schleierhaft, warum Europäer gegen Ceta und TTIP auf die Straße gehen, weil die USA angeblich europäische Umwelt-, Sozial- und Arbeitsnormen verletzen, aber unsere Datenstandards geben wir freiwillig auf, indem wir den Silicon-Valley-Kapitalismus rundweg akzeptieren – und untergraben dabei unsere Demokratie.
Vielleicht wissen viele Leute gar nicht um die Gefahr.
Nein, es ist schlimmer. Viele junge Leute der Generation Digital Natives sagen, das ist doch unsere Privatsache, wenn wir da mitmachen und unsere Freiheitsrechte aufgeben. Wir als ältere Generation scheinen bei der politischen Bildung unserer Kinder da offenbar völlig versagt zu haben. Denn in der digitalen Ära geht es ums Ganze – und das Ganze hat mehr Gewicht als die vertragsrechtlichen Möglichkeiten des Einzelnen. Hier muss der Staat den Bürger vor sich selber schützen. Es darf nicht sein, dass die Bürger ihre Grundrechte einfach aufgeben können, indem sie ein Kreuzchen bei den Nutzungsbedingungen machen.
Wollen die großen Internetkonzerne die Demokratie abschaffen, oder passiert das quasi nebenbei, weil sie ihre Geschäfte machen?
Es gibt Stimmen im Silicon Valley, die offen sagen, die Demokratie sei eine alte Technologie, man müsse etwas Neues ausprobieren, etwa die Gesellschaft so lenken wie einen Start-up. Man akzeptiert nur noch datengetriebenes Denken. Entscheidungen sollen allein auf Daten basieren. Andere Konzepte wie demokratische Debatten, Bürgerpartizipation, steuerliche Finanzausgleiche anstelle von Kapitalbeteiligungen des außerbörslichen Marktes an Ländern oder Städten seien gestrig, überkommen, überholt. Mir scheint das eine teuflische Ideologie zu sein. Auf jeden Fall würde sie in einen kalten Staat führen.
Wie kann man die Macht der Internetkonzerne brechen?
Der Markt muss reguliert werden. Es geht nicht darum zu sagen, die Technologie ist schlecht, oder die künstliche Intelligenz ist böse. Es geht darum, dass gerade eine weitere Metamorphose des Kapitalismus stattfindet. Nach dem Finanzkapitalismus tritt der Informationskapitalismus in unser Leben. Im 21. Jahrhundert verdient man viel Geld mit Daten und Information. Die Konzerne haben das erkannt und treiben die Entwicklung voran. Es ist also ein neuer Markt entstanden, der nun auch reguliert werden muss.
Grafik: Das ist in einem smarten Haus möglich

Hirnforscher wütet gegen Digitalisierung
Kapitel 15Hirnforscher wütet gegen Digitalisierung
- Von Yannick Dillinger und Ludger Möllers
Hirnforscher wütet gegen Digitalisierung
Hirnforscher wütet gegen Digitalisierung

Nein, da bin ich anderer Ansicht. Wir registrieren bei jungen Menschen durch die Nutzung digitaler Medien eine Abnahme des kognitiven Leistungsniveaus. Die Digitalisierung nimmt ihnen geistige Arbeit ab. Dadurch trainieren sie das Gehirn weniger. Sie lagern Wissen aus. Sie verlernen zu lernen. Das ist gefährlich. Und es ist großer Unfug zu sagen: Wir brauchen nichts mehr zu lernen, wir können ja googeln. Wenn Sie kein Wissen haben, können Sie gar nichts ordentlich googeln. Sie brauchen Vorbildung, um die Spreu vom Weizen zu trennen.
Heißt das, Schulen müssen jungen Menschen beibringen, clever zu googeln?
Schulen müssen jungen Menschen Wissen vermitteln. Breitestes Wissen. In vielerlei Bereichen. Sodass sie befähigt sind, ihr ganzes Leben lang selbst weiterzulernen. Das Gegenteil ist aber vielerorts zu beobachten. Ein Beispiel: Ab der Klassenstufe, in der Taschenrechner eingesetzt werden, verlernen die Kinder Kopfrechnen. Weil sie es nicht mehr müssen. Mal eben schnell im Kopf 8 mal 4 rechnen – das machen sie eben nicht mehr. Deshalb halte ich Taschenrechner für keine gute Idee in der Mittelstufe.
Ich durfte in der Schule früh Taschenrechner nutzen, habe im Beruf viel mit digitalen Medien zu tun und wusste eben doch relativ schnell, was 8 mal 4 ergibt…
Das mag sein. Sie haben Glück gehabt und sind sich wahrscheinlich im Klaren gewesen, dass es geschickt ist, wenn Sie die wichtigsten Sachen noch im Kopf haben. Ein Einzelfall sagt allerdings gar nichts aus. Wenn ich argumentiere, habe ich wissenschaftliche Belege.
Sie argumentieren seit Jahren in Ihren Büchern. Ihr Bestseller „Digitale Demenz“ ist als E-Book erhältlich. E-Books sind digitale Medien. Ist die Lektüre Ihres Buches gefährlich?
Ich bin gegen E-Books – aber nur, wenn sie vermeintlich verbessert werden: etwa mit Videos statt Abbildungen, mit Hyperlinks statt Quellenangaben. Das E-Book von „Digitale Demenz“ ist eine Eins-zu-Eins-Kopie des gedruckten Buches. Der Inhalt wird vielleicht ein wenig schlechter behalten, das kann sein. Aber damit kann ich leben. E-Books haben eben einen Markt – wenn auch einen kleinen. Gerade für Frauen jenseits der 40 Jahre, die keinen Urlaub machen können, ohne Koffer voller Bücher dabeizuhaben, sind E-Books toll: Sie müssen weniger schleppen.

Hirnforscher wütet gegen Digitalisierung
Hirnforscher wütet gegen Digitalisierung

Wenn erwachsene Menschen diese Plattformen nutzen, um mit anderen in Kontakt zu bleiben, dann ist das sicherlich nicht schlimm. Wenn aber Kinder und Jugendliche, die beispielsweise das Dechiffrieren von Mimik und Gestik erst lernen müssen, sieben Stunden in Facebook abhängen, dann halte ich das für gefährlich. So erlangen sie keine soziale Intelligenz. Müssen sie aber, wenn sie empathiefähig sein sollen. Studien belegen eindeutig: Je mehr Bildschirm, desto weniger Empathie.
Kritiker werfen Ihnen vor, zweifelhafte Studien zu zitieren und auf komplexe Fragen zu einfache Antworten zu geben…
Halt, stopp. Da sage ich meinen Kritikern: Ich schenke euch, dass die Welt beliebig kompliziert ist. Wissenschaft besteht genau darin, aus dem Komplexen der Welt Einzelfaktoren zu isolieren und dann zu schauen, wie groß deren Einfluss ist. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass dreckige Luft Lungenkrebs macht, dass es genetische Faktoren gibt, die Lungenkrebs befördern, dass es Radium im Boden gibt, das Lungenkrebs verursacht. Aber die größte Wahrscheinlichkeit, Lungenkrebs zu bekommen, bringt das Rauchen mit sich. Genau so und keinen Deut anders ist meine Argumentation hinsichtlich der Gefahren der Digitalisierung – und da bleibe ich ganz auf dem Boden der Wissenschaft.
Sie mögen keine Einzelfälle, verstanden. Nun gibt es aber beispielsweise im Silicon Valley recht viele intelligente Menschen, die sich seit frühester Jugend und nahezu permanent mit Digitalem beschäftigen…
Ja und? Da sind wir doch wieder beim Thema Soziales. Zumindest zwischenmenschlich können Sie viele von denen nicht gebrauchen. Viele Computer-Fachleute sind Autisten. Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Jeff Bezos: Ich wollte die alle drei nicht zum Chef haben. Das sind Gesetzlose, die machen überall Geld, zahlen keine Steuern. Das sind Parasiten unserer Gesellschaft, die den guten Willen und den Glauben der Menschen ausnutzen und abzocken. Dass wir diesen Menschen erlauben, die Gehirne der kommenden Generationen zu vermüllen und unsere Kultusministerien da noch helfen, das ist einfach nur ein großer Skandal.
Ihnen glauben auch viele Menschen, Sie verdienen auch viel Geld mit dem Thema „Digitalisierung“…
Niemand muss mir „glauben“, es reicht mir völlig, wenn sich Menschen mit meinen Argumenten auseinandersetzen und die wissenschaftlichen Studien zur Kenntnis nehmen, mit denen ich argumentiere. Und niemand hat mir bisher vorgeworfen, dass ein Sachbuch, das mehr als 700 Literaturstellen anführt, im Buchhandel etwas kostet. Über das Argument, der Spitzer kassiere ab, indem er Menschen Angst macht, lache ich. Nicht ich mache den Menschen Angst, sondern die, die von digitaler Disruption sprechen. Das ist übelster Sozial-Darwinismus. „Fressen oder gefressen werden“ – das sagen die vor vollen Hallen, wollen dafür noch Begeisterung entfachen und kommen damit durch. Das ist übelste Angstmache.

Hirnforscher wütet gegen Digitalisierung
Hirnforscher wütet gegen Digitalisierung

Das gab es doch schon immer. Nur hat man nicht noch gesagt: „Hey klasse, noch mehr davon.“ Wenn Uber tatsächlich die Taxen übernimmt, dann wird einer zum Milliardär und Hunderttausende werden arbeitslos. Wollen wir das eigentlich? Nee. Ich hoffe, die EU ist schlau genug, dass sie gegen diesen Wildwest-Kapitalismus, der da dahintersteckt, was tut.
Auch Ihre Disziplin, die Medizin, ist an vielen Stellen digitalisiert worden. Ist sie dadurch besser geworden?
Ja klar. Aber im Moment sieht es so aus, als würde sie auch wieder schlechter. Die meiste Medizintechnik funktioniert nur noch mit Computern. Was Sie aber nicht algorithmisieren können, ist das Leben selbst. Wenn Sie nur noch den Watson nach einer Diagnose fragen, dann denkt keiner mehr nach. Das ist das Schlimmste, das der Medizin passieren kann.
Gibt es digitale Errungenschaften, die Sie in Ihr Leben reinlassen?
Natürlich, alles. In meinem Leben gibt es Smartphones und Computer. Wenn ich Urlaub an der Ostsee mache, habe ich WLAN und komme an jede wissenschaftliche Publikation in fünf Sekunden. Da kann ich Bücher schreiben. In aller Einsamkeit und Ruhe, die ich dafür auch brauche. Ich habe nichts gegen digitale Medien. Wo etwas Wirkung hat, gibt es auch Risiken und Nebenwirkungen. Das ist alles, was ich sage.
Wie schreiben Sie Ihre Bücher? Auf Papier oder am PC?
Natürlich am PC.
Haben Sie keine Angst, dabei etwas weniger schlau zu werden?
Nein, ich denke dabei ja nach. Ich daddel nicht. Es ist ja nicht der Bildschirm, der dumm macht. Sondern die falsche Nutzung.
Wo ziehen Sie denn die Grenze?
Ich nutze digitale Medien nicht auch noch zur Freizeitgestaltung. Wie dämlich wäre das denn auch? Und meine Kinder erst recht nicht. Keine Playstation, keine Spiele. Das ist alles nur vertane Zeit, die man besser einsetzen kann. Lernen bildet, Daddeln nicht.
Professor Manfred Spitzer (58) ist der ärztliche Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III an der Universitätsklinik Ulm und renommierter Hirnforscher. In seinen Publikationen setzt er sich mit den Risiken und Nebenwirkungen der Digitalisierung auseinander.

Um externe Dienste auszuschalten, hier Einstellungen ändern.
Nachlässig beim Nachlass
Nachlässig beim Nachlass
- Von Ludger Möllers
Nachlässig beim Nachlass
Nachlässig beim Nachlass

„Noch haben wir vielleicht drei Fälle pro Jahr, bei denen wir uns mit dem digitalen Nachlass auseinandersetzen müssen“, sagt der Tuttlinger Bestatter Ralf Martin, „dabei geht es hauptsächlich um Versicherungen, manchmal auch Konten.“ Aber: Alle zwei Minuten stirbt in Deutschland ein Facebook-Nutzer, ohne dass geregelt ist, was mit geposteten Inhalten, Likes und Fotos passiert. Dabei wird das Problem in Zukunft noch größer: „Die Generation, die das ausführlich nutzt, kommt ja erst“, sagt Sabine Petri, Referentin für Datenschutz bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Der fiktive, konstruierte Fall Schulze wäre heute schon kein Einzelfall mehr. 87 Prozent aller Teilnehmer einer Studie der DEVK-Versicherung betrachten ihre Online-Banking-Daten zwar als wichtig oder sehr wichtig. Doch neun von zehn Internetnutzern (93 Prozent) haben laut einer aktuellen Studie des IT-Verbands Bitkom nicht festgelegt, was im Todesfall mit ihren Daten aus Social-Media-Profilen oder ihren persönlichen E-Mails passieren soll. Der Grund: mangelndes Wissen. 78 Prozent der Befragten fehlen die wichtigsten Informationen, um ihren digitalen Nachlass regeln zu können.
Die Fachleute vom IT-Verband Bitkom empfehlen, rechtzeitig und schriftlich festzuhalten, was im Todesfall mit den Daten passieren soll. Ist im Testament nichts anderes geregelt, erben die Hinterbliebenen laut Bitkom alle Gegenstände des Verstorbenen. Dazu zählen auch Computer, Smartphones oder andere physische Datenspeicher. Darauf hinterlegte Daten können sie dann uneingeschränkt einsehen. Wünscht man das aber nicht, kann ein beauftragter Nachlassverwalter oder Notar diese Geräte vernichten oder eine Löschung veranlassen.

Nachlässig beim Nachlass
Nachlässig beim Nachlass

Ähnlich sieht es bei Versicherungen aus: Wer seine Versicherungsangelegenheiten online regelt, muss für den Notfall keine Zugangsdaten wie Passwörter für die Bezugsberechtigten hinterlassen. „Bezugsberechtigte und Erben erhalten alle nötigen Informationen von der Versicherung“, informiert Karina Hauser, Versicherungsexpertin bei CosmosDirekt. Der Anbieter der Lebensversicherung gibt im Ernstfall Auskunft darüber, mit welchen Unterlagen sich eine Bezugsberechtigung nachweisen lässt.
Im Gegensatz zum Erbrecht an Sachgegenständen ist nach deutschem Recht derzeit nicht eindeutig geklärt, ob Erben Zugriff auf E-Mails, Facebook-Fotos, intime Chat-Protokolle auf Skype oder Dateien mit streng vertraulichen Inhalten bekommen können, weiß Professor Mario Martini, Lehrstuhlinhaber an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Martini: „Der deutsche Gesetzgeber schweigt sich zum digitalen Nachlass bisher komplett aus.“
Widersprüchlich ist die Praxis bei E-Mails. Anbieter müssen aus Sicht der Verbraucherschützer Zugriff gewähren. VZBV-Expertin Schröder: „Denn hier laufen die Informationen über Verbindlichkeiten zusammen.“ Bei E-Mail-Diensten spielt aber zusätzlich das Fernmeldegeheimnis eine Rolle, deshalb gewähren Anbieter häufig keinen Zugriff auf die Konten. Den Zugang bekommen Angehörige von den Anbietern nur, solange der postmortale Persönlichkeitsschutz des Verstorbenen nicht betroffen ist.
Gegenüber Cloud-Anbietern haben Hinterbliebene häufig ein Sonderkündigungsrecht. Damit vom Fernmeldegeheimnis geschützte Daten nicht unrettbar verloren gehen, sollten also auch für diesen Bereich schon zu Lebzeiten Regelungen getroffen werden. Zugangsdaten können beispielsweise bei einem Notar hinterlegt werden.

Nachlässig beim Nachlass
Nachlässig beim Nachlass

Bei Facebook heißt es: „Du kannst uns im Voraus mitteilen, ob dein Konto in den Gedenkzustand versetzt oder dauerhaft aus Facebook gelöscht werden soll.“ Konten im Gedenkzustand stellen, so schreiben es die Betreiber, „für Freunde und Familienangehörige eine Möglichkeit dar, zusammenzukommen und Erinnerungen zu teilen, wenn eine Person verstorben ist“.
Zu den digitalen Hinterlassenschaften zählen auch offene Geschäfte in Online-Shops oder etwa bei Auktionsplattformen. Die Erben treten in vollem Umfang in die Rechte und Pflichten aus geschlossenen Verträgen ein. Sie müssen daher etwa Verkäufe oder Versteigerungen des Verstorbenen abwickeln und getätigte Käufe entgegennehmen und bezahlen, erklären die Experten.
Der Tuttlinger Bestatter Ralf Martin fasst seine Tipps zusammen: „Um den Nachlass regeln zu können, muss ich wissen: Wo ist der Verstorbene digital unterwegs gewesen? Wo sind die Passwörter? Wo muss ich ihn abmelden?“ Und Martin weist auf eine Falle hin: „Die Erben haften in jedem Fall, auch falls nach dem Tod noch Kosten anfallen.“ Daher sei Vorsorge wichtig. Ein Ordner mit den wichtigsten Unterlagen müsse auch die Angaben zum digitalen Leben enthalten.

Nachlässig beim Nachlass
Nachlässig beim Nachlass

Weil sich die Angaben häufig ändern, ist es wahrscheinlich zu teuer und zeitaufwendig, solch eine Anleitung bei einem Notar zu hinterlegen. Mittlerweile haben sich Firmen etabliert, die den Angehörigen und Bestattern die Arbeit abnehmen. Die Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin rät aber davon ab, den Computer des Verstorbenen an Firmen zu schicken, die die vorhandenen Daten analysieren, ein Gutachten erstellen und auf Wunsch Online-Konten löschen. Denn so würden viele persönliche Daten an Dritte weitergegeben. Besser seien Firmen, die anbieten, mit wenig persönlichen Daten wie Name und Anschrift des Verstorbenen bei den größten deutschen Online-Unternehmen zu überprüfen, welche Konten und Verträge existieren.
Auch gibt es Unternehmen, die gegen eine Gebühr anbieten, Passwörter und Anweisungen in einer Cloud zu hinterlegen und im Todesfall an den Erben zu übergeben. Davon rät der VZBV ebenfalls ab: Um sich vor Diebstahl und Betrug zu schützen, sollten Passwörter nicht an Dritte weitergegeben werden.
Wer sich das Durchforsten des Rechners Verstorbener nicht alleine zutraut und keine Fremdfirmen einschalten will, kann sich auch von Trauerbegleitern helfen lassen. „Wir schauen, ob ein Abo gekündigt werden muss oder gerade ein Gegenstand des Verstorbenen auf einer Auktionsplattform einen Käufer gefunden hat“, erklärt die Theologin Birgit Aurelia Janetzky, die sich in Freiburg auf Dienstleistungen rund ums digitale Erbe spezialisiert hat. „Wenn es nach der Untersuchung um die Verwertung oder Löschung von Daten geht, brauchen wir einen Nachweis der Erbberechtigung.“
Eine Datensuche kann natürlich auch Unangenehmes zutage fördern, etwa ein unerwartetes Filmarchiv oder E-Mails, die eine Affäre belegen. Wie bei dem verstorbenen Wolfgang Schulze, dessen Frau im Freundeskreis Rat suchte und fand. „Ich will niemanden schockieren. Aber wenn ich etwas Delikates finde, suche ich das Gespräch mit den Hinterbliebenen“, sagt Janetzky, die vorher in der Trauerbegleitung gearbeitet hat. „Die Erben müssen so oder so damit umgehen.“

Impressum
Impressum
Yannick Dillinger, Benjamin Wagener, Daniel Drescher, Jasmin Off, Andreas Knoch, Ludger Möllers, Sigrid Stoss, Barbara Waldvogel, Ingrid Augustin, Simon Haas, Kara Ballarin, Katharina Dodel
Fotos / Grafiken / Videos
Johanna Jani / Mark Hildebrandt / Mark Hänsgen / Simon Haas / dpa / ARD / Bundeswehr / Colourbox / Google / Galileo
Verantwortlich
Yannick Dillinger
Kontakt
www.schwäbische.de
Karlstraße 16
88212 Ravensburg
Telefon: 0751 / 2955 5555
online@schwaebische.de
Copyright
Schwäbische Zeitung 2016 - alle Rechte vorbehalten





























































































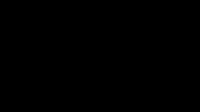 Digitales Leben
Digitales Leben
 Inhalt
Inhalt
 So leben wir 2040
So leben wir 2040
 Die erfundene Realität
Die erfundene Realität
 Die virtuelle Realität
Die virtuelle Realität
 Das entmenschlichte Bankgeschäft
Das entmenschlichte Bankgeschäft
 Das unsichtbare Schlachtfeld
Das unsichtbare Schlachtfeld
 Wie verändern sich Beziehungen durch das Digitale?
Wie verändern sich Beziehungen durch das Digitale?
 Kann der Ärztemangel digital aufgefangen werden?
Kann der Ärztemangel digital aufgefangen werden?
 3-D-Drucker: Die Fabrik der Zukunft
3-D-Drucker: Die Fabrik der Zukunft
 Expertin warnt vor der IT-Industrie Amerikas
Expertin warnt vor der IT-Industrie Amerikas
 Nachlässig beim Nachlass
Nachlässig beim Nachlass
 Nachlässig beim Nachlass
Nachlässig beim Nachlass
 Impressum
Impressum