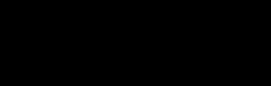Die große Krise
Unsere Bauern
In der Serie „Unsere Bauern“ begleitet die „Schwäbische Zeitung“ Landwirte bei ihrer Arbeit, geht auf die Suche nach den Ursachen der Krise und wagt einen Blick in die Zukunft eines Wirtschaftszweigs, der das Land prägt wie kaum ein zweiter.
Diese Reportage enthält neben Texten auch Panorama-Fotos und interaktive Videos.
Inhalt

Kapitel 1 Die große Krise
Kapitel 1 Die große Krise

Wichert selbst trifft die Krise als Ferkelerzeuger besonders hart – auch wenn sich die Preise seit ihrem Tiefpunkt im Dezember 2015 wieder etwas erholt haben. „Es ist schon bitter, mit ansehen zu müssen, dass Kollegen ernsthaft überlegen, ihre Ställe lieber leer stehen zu lassen, anstatt mit jedem Schwein noch mehr Verluste zu machen.“ Während in der Landwirtschaft gemeinhin von Strukturwandel die Rede ist – gemessen an der Zahl der Höfe die aufgeben – spricht man bei den Schweinehaltern inzwischen nur noch von Strukturbruch. Doch was genau macht die aktuelle Krise so besonders? Wie sieht sie konkret aus? Und wo liegen die Gründe für den Preisabsturz?
Wie hart die Misere die Landwirte trifft, hängt vor allem vom jeweiligen Betriebsschwerpunkt ab. Während Kartoffelbauern in den vergangenen Jahren vergleichsweise gut verdient haben und Rücklagen bilden konnten, erreicht die Krise für Milchvieh- und Schweinehalter zurzeit eine ganz neue Härte. So bekommen Erzeuger in einzelnen Regionen Deutschlands nicht einmal mehr 20 Cent für den Liter Milch. Um kostendeckend zu produzieren sind 35 bis 40 Cent nötig. Das Kilogramm Schweinefleisch bringt aktuell gut 1,60 Euro für den Züchter. Die Kosten liegen jenseits der 1,80-Euro-Marke.
Der Vorzeigebauer
Kapitel 2 Der verzagende Vorzeigebauer
Kapitel 2 Der verzagende Vorzeigebauer

Es ist einer der nicht gerade üppig gesäten schönen Sommerabende dieses Jahres. Von der Terrasse des modernen Wohnhauses der Familie Reich geht der Blick über weite, flache Felder. Grünland dominiert. So ein freier Blick ist eher unüblich für Oberschwaben, aber der Aussiedlerhof der Reichs liegt mitten im Schussental bei Weiler, einem Teilort der Gemeinde Berg im Landkreis Ravensburg. Vor 13 Jahren sind sie hierher gezogen, weil die Emissionsschutzbestimmungen eine Hoferweiterung drüben im Dorf verhindert haben. Großzügig wirkt dieser neu gebaute Bauernhof – und extrem aufgeräumt und sauber. Links vom Wohngebäude steht der Kuhstall, die Rolltore sind vorne und hinten offen. Ab und zu dringt ein gelangweilte „muh“ nach draußen. Es gibt noch ein Wirtschaftsgebäude sowie die Fahrsilos, in denen der gehäckselte Mais der letzten Ernte gelagert ist. Vor dem Stall steht ein grüner Traktor, der nicht untermotorisiert wirkt. Alles in allem: ein modernes landwirtschaftliches Idyll.
Ralf Reich erklärt seinen Kuhstall
Im Winter kann es im Stall kalt werden
So melkt der Landwirt
Sehen Sie hier den Hof von Landwirt Ralf Reich in einer interaktiven 360-Grad-Tour.
Video: So züchtet Ralf Reich seine Kühe
Video: Darum steigt Bauer Reich nicht auf Bio um
Schlaraffenland für Schnäppchenjäger
Kapitel 3 Wie Großkonzerne den Markt unter sich aufteilen
Kapitel 3 Wie Großkonzerne den Markt unter sich aufteilen


Beim Thema Milchpreis schauen alle auf die Handelskonzerne: Vier große Anbieter beherrschen den Markt. Nach Angaben des Bundeskartellamtes teilen sich Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland 85 Prozent des Kuchens. Dabei hat die Konzentration in den letzten Jahren rasant zugenommen: „1999 hatten wir bundesweit noch acht große Lebensmittelhändler mit 70 Prozent Marktanteil“, moniert der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt. Die Ablehnung der Übernahme von Kaiser’s Tengelmann durch den Branchenprimus Edeka ist für ihn deshalb schlüssig.
Hinter der Preisdrückerei wird also die geballte Einkaufsmacht der großen Konzerne vermutet, die den rund 6000 Herstellern von Lebensmitteln, die Kondionen diktieren können. Auf dem 160 Milliarden Euro schweren Lebensmittelmarkt tobt ein harter Wettbewerb: Die Jagd nach Marktanteilen führt zu Schnäppchenpreisen. Der zweite Grund ist der hohe Discounter-Anteil: Mehr als 40 Prozent des Umsatzes entfallen auf Aldi, Lidl und Co - und die haben uns Deutsche zu echten Pfennigfuchsern erzogen, meint Wolfgang Adlwarth, Handelsexperte bei der Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg: „Die Discounter haben über Jahre den Preis als Kaufargument in den Vordergrund gerückt.“ Profiteure sind die Verbraucher: „Im europäischen Vergleich sind die Lebensmittelpreise in Deutschland niedrig.“

Bauern und Landschaftsschutz
Kapitel 4 Bauern und der Landschaftsschutz
Kapitel 4 Bauern und der Landschaftsschutz

Vor allem Milchwirtschaft wird in jener Ecke betrieben. Grünland herrscht vor, genutzt als Weide und als Futterlieferant für das Vieh im Stall. So war es seit Generationen. So ist es vielleicht auch künftig noch – vorausgesetzt, die Bauern können mit ihrem Tun Geld verdienen. Im Bereich der kriselnden Milchwirtschaft ist eine Prognose schwer. Ohne Bauern wird die landschaftlich offene Gegend aber rasch anders aussehen.
Was passieren könnte, lässt sich am Schwarzwald zeigen. Die Beweidung des Mittelgebirges wurde Zug um Zug aufgegeben. Der Wald kam zurück. In diesem Fall erneut als Kulturlandschaft in Form von forstlichen Fichten-Monokulturen. Inzwischen gibt es den nächsten Wandel. Klimastabiler Mischwald soll nach dem Willen der Förster wachsen. Im Norden ist ein Nationalpark gegründet worden. Das Ziel: Wildnis. Diese gesellschaftlich durchaus umstrittene Art der Landschaftsform entsteht in manchen Ecken der Allgäuer Alpen oder des benachbarten Bregenzer Wald bereits ohne menschliche Planung. Abgelegene, in modernen Zeiten unrentabel gewordene Hochweiden werden aufgegeben. Sie verbuschen. Das gewohnte Bild von sanften Bergwiesen schwindet. Statt Alm-Idylle stößt man auf Disteln und Krüppelkiefern.
Bedroht sind auch andere Formen der Kulturlandschaft, etwa Streuobstwiesen am Bodensee oder Wachholderheiden auf der Schwäbischen Alb. Öko-Freunde schätzen sie als besonderes Refugium für allerlei Pflänzchen und Getier. Doch die Streu wird nicht mehr gebraucht, Apfelwirtschaft findet in Plantagen statt. Wachholderheiden wiederum existieren nur so lange, wie noch die selten werdenden Schafherden darauf weiden. Sollte man nun mit Hilfsmaßnahmen eingreifen, um die Landschaft so zu erhalten, wie sie von der Bewirtschaftung geformt wurde?
Dabei fließen seit Längerem Mittel zur Konservierung altehrwürdiger Kulturlandschaften. Es gibt öffentliche Gelder für den Schutz von Streuobstwiesen. Über das Agraumweltprogramm FAKT wurden im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg rund 19 Millionen Euro für die Landschaftspflege ausgeschüttet.
Ein Rind im Trend
Kapitel 5 Ein Rind im Trend
Kapitel 5 Ein Rind im Trend

Der Stall von Georg Mayr ist geräumig, die Holzbalken noch hell. Erst vor drei Jahren wurde der Bau errichtet. Gut 120 Rinder hält Mayr auf seinem Bio-Hof in Riegsee bei Murnau, vor allem Ochsen. Ein Drittel davon sind Murnau-Werdenfelser, die hier viel Bewegungsfreiheit haben. „Zehn Quadratmeter Fläche pro Tier“, sagt Mayr. „Das ist das eineinhalbfache von dem, was für einen Biobetrieb vorgeschrieben ist.“
Bis vor drei Jahren war Georg Mayr ein Milchbauer. Einer, der bei jedem Protestzug für höhere Erzeugerpreise dabei war, in Berlin und in Brüssel. „Eine Katastrophe“ sei der Verfall des Milchpreises, sagt er. Irgendwann hat es ihm gereicht. Mayr suchte sich ein anderes Geschäftsfeld. Und sattelte um von der Milch- auf die Fleischproduktion, für regionale Abnehmer in der Gastronomie. Seine Nische fand er mit den Murnau-Werdenfelsern. „Die sind nicht so schwer, eine niedrigere Rasse“, sagt Mayr. „Die Fleischleistung ist 15 Prozent niedriger als beim Fleckvieh.“ Trotzdem lohnt sich das Geschäft, weil das Fleisch hochpreisiger ist. Der Trend, dass ein Teil der Konsumenten für regionale Lebensmittel aus ökologischer Produktion bereit sind, mehr Geld auf den Tisch zu legen, ist die Grundlage für Mayrs Geschäft – und wohl auch für das Überleben des Murnau-Werdenfelser Rindes an sich.
Dicke Luft im Schweinestall
Kapitel 6 Dicke Luft im Schweinestall
Kapitel 6 Dicke Luft im Schweinestall

Als Beweis legt Wichert, der als Vorsitzender des Schweinezuchtverbandes Baden-Württemberg die Nöte der Kollegen aus dem Effeff kennt, aktuelle Zahlen vor. Und die zeichnen ein Bild des Niedergangs: So ist die Zahl der Schweinehalter im Südwesten in den vergangenen fünf Jahren von 3600 auf 2400 zurückgegangen. Ferkelzüchter – traditionell eine Domäne im Südwesten – gab es 2011 rund 1800 in Baden-Württemberg; heute sind es noch 1100. Und bei der Anzahl der Tiere ist mit rund 1,8 Millionen Sauen das Niveau des Jahres 1963 erreicht.
„Die Situation ist desaströs. Wir haben es am Schweinemarkt mit einem regelrechten Strukturbruch zu tun“, sagt Wichert, der selbst Ferkelzüchter ist – rund 120 Muttersauen und etwa zehn Mal so viele Ferkel zieht er an drei Standorten in und um Oberdischingen, in der Nähe von Ehingen, auf. Eine seit Jahren anhaltende ruinöse Preissituation raube den Betrieben die Perspektiven. Seit dem Sommer 2014 ist der Kilopreis für Schweinefleisch (Schlachtgewicht), den Erzeuger wie Wichert erlösen, von 1,80 auf 1,25 Euro zum Jahreswechsel 2015/16 gefallen. Die Gründe dafür sind das Rußland-Embargo, durch das ein wichtiger Exportmarkt für Schweinefleisch komplett ausgefallen ist, der anhaltende Preisdruck für Schweinefleisch am Weltmarkt, ausgelöst durch eine geringere Nachfrage in wichtigen asiatischen Abnehmerländern wie etwa China und eine massiv hochgefahrene Produktion in Staaten mit günstigeren Kostenstrukturen wie Spanien und Brasilien sowie – ein primär deutsches Phänomen – die Konzentration am Ende der Wertschöpfungskette bei Schlachtereien und im Lebensmitteleinzelhandel, wo jeweils eine Handvoll Unternehmen den Markt dominieren und die Preise setzen.
Der Milchgipfel
Wut im Bauch
Wut im Bauch

Sie erzählt von den schwierigen Momenten, als die Klappe des Transporters zuging und ihre Kühe vom Hof geholt wurden. Und sie erzählt von einem Lebensentwurf, der sich angesichts der desaströsen Lage auf dem Milchmarkt, peu à peu in Luft auflöst, erzählt von den Verlusten, die sich bei Preisen um die 25 Cent für den Liter Rohmilch Monat für Monat auftürmen. Ernestina Frick hat Wut im Bauch. Wut auf die Politik, die ihrer Meinung nach die Situation mit zu verantworten hat. Wut auf den Deutschen Bauernverband, der den deutschen Milchbauern jahrelang von den Chancen auf dem Weltmarkt vorgeschwärmt hat. Und Wut auf die Molkereien und den Lebensmitteleinzelhandel, die ihre Marktmacht auf dem Rücken der Erzeuger gnadenlos ausspielen.
Mit ihrer Wut ist Ernestina Frick nicht allein. So wie ihr geht es der großen Masse der Milchbauern im Südwesten – einer Gegend, geprägt von kleinteiligen Strukturen und bäuerlichen Familienbetrieben, für die sich immer drängender die Frage nach der Perspektive stellt. Gut 250 von ihnen waren am Mittwoch-abend dem Aufruf der „Schwäbischen Zeitung“ in die Festhalle nach Leutkirch gefolgt, um im Rahmen eines regionalen „Milchgipfels“ mit Vertretern aus Politik und Verbänden die Lage der Branche zu diskutieren.
Neben Raimund Haser (CDU), der für den Wahlkreis Wangen im Stuttgarter Landtag sitzt, stellten sich der Vorsitzende des Bauernverbandes Allgäu-Oberschwaben und Bundestagsabgeordnete Waldemar Westermayer (CDU), und die Europaabgeordnete Maria Heubuch (Bündnis 90/Die Grünen) – selbst Milchbäuerin – der Diskussion. Moderiert wurde der Abend von Benjamin Wagener, Chef der Wirtschaftsredaktion der „Schwäbischen Zeitung“, und Herbert Beck, dem Leiter der Lokalredaktion Leutkirch.
„Die letzten, die wir haben!“
Kapitel 8 „Die letzten, die wir haben!“
Kapitel 8 „Die letzten, die wir haben!“

Seit 1949 existiert die Bauernschule als Weiterbildungseinrichtung des Landesbauernverbandes. So wie der Hof ein Bild des Bauern ist, so verkörpert die aus gediegenen schweren Materialien errichtete Schule die Bodenständigkeit und die Wertschätzung für das Lokale. Auch die eigene Hauswirtschaft mit sehr schmackhaftem Drei-Gänge-Menü verwendet Produkte von hier. Der frühere Landwirt Oehler prophezeit dem Bauerntum eine gute Zukunft. Und er gerät ins Schwärmen, wenn er vom Gefühl spricht, wenn einem der gerade gedroschene Weizen durch die Finger rinnt.
Auf Augenhöhe
Kapitel 9 Auf Augenhöhe
Kapitel 9 Auf Augenhöhe

Vom Wohnzimmertisch des 44-Jährigen ist der Grünten zu sehen, der Berg am Eingang des Illertals, der wegen seiner markanten Lage den Beinamen Wächter des Allgäus trägt.Im Stall des Hofes standen zu Zeiten von Peter Mangolds Vater Milchkühe. Braunvieh, das so typisch ist für die sanften Hügel des Allgäus. Erst der Sohn, der die Landwirtschaft bereits aufgeben wollte, mehrere Jahre lang bei Wacker Chemie in Kempten arbeitete und Mitte der 1990er-Jahre reumütig nach Sulzberg zurückkehrte, stellte den Betrieb auf Schafwirtschaft um. „Ich bin leidenschaftlicher Landwirt, das ist meine Berufung“, sagt Mangold. Berufung hin, Leidenschaft her, klar war aber schon damals: Für die konventionelle Milchviehhaltung war der Hof mit seinen 26 Hektar viel zu klein, um ihn wirtschaftlich zu führen. „Ich wollte den Betrieb langfristig weiterbewirtschaften, und bei dieser Größe musste ich nach Alternativen suchen“, erzählt Mangold. Und die hat der Mann mit dem offenen Blick und den Schafferhänden, die immer nach Halt suchen, wenn sie nach nichts greifen können, gefunden – in der Direktvermarktung von Biokäse und Biojoghurt aus Schafsmilch.
Die Geschichte von Peter Mangold steht für das Dilemma vieler bäuerlicher Betriebe in Süddeutschland – und für einen möglichen Ausweg aus dem Dilemma. Die kleinen Bauernhöfe mit Milchwirtschaft, wie sie in Oberschwaben, im Allgäu, wie sie zwischen Bodensee, Schwarzwald und Schwäbischer Alb überall zu finden sind, können nicht mit den großen Landwirtschaftsfabriken in Norddeutschland, in Irland oder Neuseeland konkurrieren. Wenn ein Bauer in Wangen 25 Milchkühe hält, hat ein Landwirt in Friesland 70 Tiere und sein Kollege auf der Grünen Insel 100. Bei Preisen, die für Landwirte in Norddeutschland noch wirtschaftlich rentabel sind, würden Bauern wie Peter Mangold schon lange draufzahlen.
Der Allgäuer ist dieser Klemme mit der Direktvermarktung von Bioprodukten entkommen. Doch das hat Peter Mangold nicht allein geschafft, er hatte einen Partner an seiner Seite. Deshalb ist die Rettung des bäuerlichen Betriebs in Sulzberg am Fuße des Grünten auch die Geschichte des Lebensmittelhändlers Feneberg in Kempten. Das Unternehmen übernimmt für Peter Mangold die Vermarktung von Käse und Joghurt, die für den alleinstehenden Bauern viel zu aufwendig wäre. Und zwar mit klaren Absprachen: Feneberg hat sich vertraglich verpflichtet, jedes Jahr eine vorab vereinbarte Menge von Joghurt und Käse abzunehmen – zu festen Preisen. „Diese Sicherheit ist sehr viel wert, so kann ich planen – letztlich ist sie die Basis dafür, dass mein Betrieb stabil dasteht“, sagt Mangold. Und so kommt es, dass der Joghurt und der Käse, den der Allgäuer auf dem elterlichen Hof in Sulzberg selbst herstellt, in den 76 Märkten der Feneberg AG zu finden ist.
So schön kann Traktor fahren sein
Kapitel 10 So schön kann Traktor fahren sein
Kapitel 10 So schön kann Traktor fahren sein

Müller steigt ab, nimmt ein Blatt Papier, auf das er die Umrisse des Ackers gezeichnet hat, und erklärt, warum die exakte Spurenführung so wichtig ist und so schwierig: Kein Acker ist genau rechtwinklig und ein gespritztes Feld sieht überall gleich aus. Mit dem Auge sieht der Bauer nicht, welche Pflanzen schon Dünger abbekommen haben. Kleine Abweichungen summieren sich jedoch auf einer Breite von 50 oder 60 Metern. „Ohne die digitale Spurenführung sind Überschneidungen beim Düngen oder Spritzen unvermeidlich“, erklärt der Landwirt. Und das bedeutet: Verschwendung von Düngemittel, Pflanzenschutz, Diesel – und Arbeitszeit.Mit solchen digitalen Lenksystemen lassen sich zwischen fünf und zehn Prozent an Betriebsmitteln einsparen und zwölf Prozent Arbeitszeit.
Das zeigt eine Modellrechnung der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Der Einsatz digitaler Karten, die Müller im Bordcomputer gespeichert hat, reduziert den Einsatz von Pflanzenschutz um zehn Prozent.Müller zählt noch andere Vorteile auf: „Der Acker wird geschont, weil der Trakor immer in den gleichen Spuren fährt“. Bedeutet: es wird weniger Ackerfläche verdichtet. „Außerdem kann ich auch nachts fahren“, ergänzt er. Das ist hin und wieder notwendig, weil manche Spritzmittel nicht in der Mittagshitze auf dem Feld verteilt werden dürfen: „Das würde die Pflanzen zu sehr strapazieren.“ Außerdem muss der Landwirt die wenigen schönen Tage in diesem Sommer voll nutzen. Dann sitzt er auch mal 14 Stunden auf dem Schlepper. An so einem Tag schafft er 60 Hektar, ein Drittel seiner gesamten Fläche: „Das ist fast wie mit der Fernbedienung vor dem Fernseher: Man sitzt bequem und drückt auf den Knopf“, sagt Müller und strahlt.
Der 36-jährige Jung-Landwirt hat den Hof in Mochenwangen bei Wolpertswende von seinen Eltern übernommen und bewirtschaftet ihn mit seiner Frau und seinen beiden Brüdern. Auch die Eltern helfen noch mit.
Wider die Vermaisung der Landschaft
Kapitel 11 Wider die Vermaisung der Landschaft
Kapitel 11 Wider die Vermaisung der Landschaft

Naturschützer stören sich an der „Vermaisung“ der Landschaft, Kritiker monieren, dass die Felder nach der Ernte brach liegen und Wind und Regen schutzlos ausgeliefert sind. Zudem lauge der Anbau von Mais die Böden aus. Kritikpunkte, die bei den Verantwortlichen einer oberschwäbischen Energiegenossenschaft die Idee hat entstehen lassen, nach einer Alternative zum so dominanten Mais zu suchen.
Die Suche könnte bald zu Ende gehen: Im Weiler Hahnennest bei Ostrach (Kreis Sigmaringen) hat die örtliche Energiegenossenschaft die sogenannte „Durchwachsene Silphie“ so weiterentwickelt, dass sie nun für den großflächigen Anbau als Energiepflanze tauglich ist. Der Bauer und Biogaserzeuger Bruno Stehle aus Sigmaringen-Laiz hat vor zwei Jahren bundesweit eine Vorreiterrolle übernommen und auf knapp zwölf Hektar die Donau-Silphie angebaut.
Die Pflanze ist die Züchtung aus Hahnennest, die sich dadurch auszeichnet, dass sie als Saatgut eine besonders hohe Keimfähigkeit von 90 Prozent hat. Derzeit sind die Züchter mit einer Optimierung der Pflanzen befasst und legen gezielt Vermehrungsflächen an. Die Silphie, die aus Nordamerika stammt, ist durch ihre große Biomasse als Energiepflanze interessant. Was ihren Anbau im großen Stil bislang behinderte, war der Umstand, dass die Setzlinge im ersten Jahr nicht genutzt werden können. So entsteht dem Landwirt ein Ertragsausfall von 5000 bis 8000 Euro pro Hektar, was die meisten Bauern vom Anbau abhielt. Außerdem keimten die Samen der Silphie schlecht, sodass es oft nicht gewährleistet war, dass die Bauern einen geschlossenen Bestand bekamen.
Der Bio-Landwirt
Kapitel 12 Der Bio-Landwirt
Kapitel 12 Der Bio-Landwirt

Seit Ende 2007 ist Bodenmiller überzeugter Biomilchbauer. Zwischen neun Uhr und 17 Uhr grasen seine Kühe auf den Weiden mit Bergpanorama. Der Biobetrieb ist um einiges aufwendiger als die konventionelle Milchproduktion, meint er. Besonders das Weiden der Tiere sei ein enormer Mehraufwand. Für die zusätzlichen Richtlinien, die mit dem Ökobetrieb einhergehen, erhält Bodenmiller mehr als doppelt so viel Milchgeld als seine konventionellen Kollegen – momentan rund 49 Cent für ein Kilogramm Biomilch. Für einige krisengebeutelte Milchbauern ist diese Differenz ein Grund, auch auf Bio umzustellen oder zumindest darüber nachzudenken. Doch ist das Ökobauer-Dasein nicht für alle der Weg aus der Krise. Einige Biomolkereien nehmen bereits keine neuen Zulieferer mehr auf.
Seit vier Jahren liefert Bodenmiller seine Milch an die Arla-Molkerei. Als er den konventionellen Milchmarkt verließ, lag die Preisdifferenz von Bio- und konventioneller Milch bei rund sechs Cent, heute sind es mehr als 20 Cent. „Den Schritt zur ökologischen Landwirtschaft bereue ich keine Sekunde“, sagt er. Für das Zertifikat Biobauer muss Bodenmiller jedoch einige Voraussetzungen erfüllen, mit denen die konventionellen Milchbauern nichts am Hut haben: Seine Kühe füttert er zu 90 Prozent mit einer Gras- und Heusilage aus eigenem Anbau. Zusätzlich bekommen seine 70 Kühe etwas Biokraftfutter. Im Stall muss der Biolandwirt mindestens sechs Quadratmeter pro Tier bereitstellen. Die Kälber müssen ebenfalls ökologisch gehalten werden, bei der Aufzucht bekommen sie Kuhmilch. Im Bereich der Tierarzneimittel musste sich Bodenmiller ebenfalls umstellen: Leistungs- und wachstumsfördernde Hormone dürfen Biobauern auch nicht verwenden. Dass sein Hof das Biosiegel zu Recht trägt, überprüft die staatliche Kontrollstelle „Abcert“ einmal im Jahr. Zusätzlich müssen sich die Ökolandwirte unangekündigten Kontrollen unterziehen. Die Entschädigung für diesen Mehraufwand liegt bei 230 Euro pro Hektar im Jahr, die der Landwirt aus Fördermitteln der EU, des Bundes sowie des Landes erhält.
Für konventionelle Milchbauern scheinen diese Fördergelder verlockend. Viele von ihnen leiden seit vielen Monaten unter den dauerhaft niedrigen Preisen – rund 3000 Landwirte haben seit 2010 in Baden-Württemberg aufgegeben. Den Ökobauern geht es deutlich besser: Der Erzeugerpreis ist in den vergangenen zwei Jahren nahezu stabil geblieben. Rund zehn Kilometer nordwestlich von Josef Bodenmiller betreibt Bernhard Jäckle in Wangen-Käferhofen seinen Biobetrieb. Die Milch seiner 25 Kühe liefert er an die Biokäserei Zurwies in Wangen. „Jetzt stellen gerade sehr viele auf Bio um“, sagt er. Viele Ökomilchbauern befürchten, dass zu viele Umsteller nun den Markt überfluten. „Der Absturz könnte auch bei uns kommen“, sagt Jäckle.
Nischenbetriebe
Kapitel 13 Wurst aus dem Automaten
Kapitel 13 Wurst aus dem Automaten

Wolfgang Gölz ist Schweinebauer in Ehingen. Das Besondere: Der Landwirt verkauft das Fleisch seiner Schweine selbst und vermarktet auch seinen Betrieb selbst. „Es ist eine Nische, in der sich Geld verdienen lässt“, sagt Gölz. Denn viele Kunden wollen wissen, wo das Fleisch, das bei ihnen auf dem Teller landet, herkommt – und darüber kann sie Gölz aufklären. Noch vor einigen Jahren hielt der Bauer auch Milchvieh und baute Kartoffeln an. Doch damit war der Landwirt nicht zufrieden. „Das hat zu wenig Gewinn gebracht“, sagt er. „Und war dafür sehr aufwendig.“ Er verkleinerte den Betrieb und spezialisierte sich auf die Schweine.
So wie Gölz können viele Landwirte nicht mehr von der konventionellen Landwirtschaft leben. Milchbauern sind abhängig von Molkereien und die zahlen derzeit für einen Liter Milch so wenig wie noch nie. Auch Schweinezüchter verdienen kaum noch etwas an ihrem Fleisch, wenn sie es an Metzgereien oder Supermärkte weiterverkaufen. Um als Landwirte trotzdem bestehen zu können, suchen sich viele von ihnen Nischen.
360 Schweine leben auf dem Hof von Gölz. Die Tiere füttert der Landwirt mit Getreide und Erbsen, die er selbst anbaut. Bei dem Fleisch seiner Tiere ist alles aus einer Hand. Nur das Schlachten der Tiere überlässt er zwei Metzgern. Zehn bis 15 Tiere werden pro Woche geschlachtet.
Vor 26 Jahren hat Gölz damit angefangen, sein Fleisch selbst zu verkaufen und zu vermarkten. Seitdem können Kunden Fleisch und Wurst direkt auf dem Hof kaufen. Mittlerweile hat der Laden nur noch einmal in der Woche geöffnet. An den restlichen Tagen können die Kunden sich Fleisch an einem Automaten auf dem Hof ziehen. Fünf Jahre nach Start des Hofladens entschied sich Gölz dazu, das Fleisch auch auf Märkten in der Region zu verkaufen. Der direkte Kontakt zu den Kunden ist ihm wichtig. „Die Leute wollen wissen, wo das Fleisch herkommt“, sagt Gölz. Für ihn hat es sich ausgezahlt, seinen Betrieb zu verkleinern und ihn neu aufzustellen. „Das Konzept hat sich bewährt, der Umsatz geht kontinuierlich nach oben“, sagt er.
Die Verbraucher werden selbstbewusst
Kapitel 14 Die Meinung eines bekennenden Genießers
Kapitel 14 Die Meinung eines bekennenden Genießers

Als Verbraucher geben wir für unser heilix Blechle über 15 Prozent des Einkommens aus, für Urlaub, Freizeit, und Kultur 17 Prozent. Und das, was wir täglich zwei- bis dreimal essen, ist uns gerade mal 13 Prozent des Einkommens wert. Unser Essen kommt aus den dicht gedrängten Fast-Food-Buden der Fußgängerzonen, aus den anonymen Fleischtheken der Supermärkte oder schlimmer noch: aus portionierten Plastikpackungen anstatt aus Metzgereien, bei denen man weiß oder mindestens fragen kann, woher das Fleisch kommt, aus „Backfactories“, in denen der Kunde die millionenfach industriell hergestellten Teiglinge möglichst noch selber in der Röhre ausbäckt, anstatt in der Bäckerei um die Ecke einzukaufen. Und von all dem schmeißen wir dann noch 20 Millionen Tonnen genießbare Lebensmittel pro Jahr in die Mülltonne. Und tragen so dazu bei, dass im letzten Jahr 3400 Milchbauern und 1400 Schweinehalter ihre Ställe dicht gemacht haben – trotz eines mit 40 Milliarden Euro prall gefüllten EU Agrarsubventionstopfs und nationaler Subventionen obendrauf. Ergebnis: Wir haben die Bauern in den letzten Jahrzehnten immer mehr von einem Markt, in dem Angebot und Nachfrage das Geschehen bestimmen, entwöhnt und zu Angestellten der EU mit Abnahmegarantie ihrer Produkte degradiert.
Das sind wenige Daten und Fakten des alltäglichen Wahnsinns, der schon seit Jahr und Tag die Erzeugung, Verarbeitung und den Verbrauch von Nahrungsmitteln ausmacht. Und die Politik? Schaut tatenlos zu, ist ja alles in ihrem Sinne, wenn immer mehr Kaufkraft in hochpreisige Dinosaurierkarossen fließt, die im Parkhaus zwei Plätze blockieren, die unsere Städte verstopfen und sie noch mit Stickoxyd und Feinstaub überziehen. Und die bäuerliche Interessenvertretung? Sie sollte eigentlich zum Schutz der bäuerlichen Landwirtschaft da sein, sollte die Verbraucher mit qualitativ hochwertigem, regional erzeugtem Fleisch, Gemüse und Obst versorgen. Aber sie treibt Hand in Hand mit der Industrie unsere Bauern auf den Weltmarkt und damit sehenden Auges in den Ruin, weil die heimische Landwirtschaft mit ihren kleinteiligen Strukturen selbst mit höchstem Einsatz von Chemie und Technik auf diesem Weltmarkt chancenlos ist. Also alles hoffnungslos? Alles weiter wie bisher, weil ja die letzten Dekaden gezeigt haben, dass die Monsantos dieser Welt im Gleichschritt mit der Politik und der Lobby der industriellen Agrarwirtschaft das Ganze beherrschen und spürbare Veränderungen kaum möglich sind?
Agrar-Bürgschaften
Kapitel 15 Bürgschaften für Bauern
Kapitel 15 Bürgschaften für Bauern

Baden-Württemberg zählt 41600 landwirtschaftliche Betriebe, davon 24000 im Nebenerwerb, 7600 Winzer und 8800 Gartenbauer. Nicht viele sind derzeit so mutig wie die Brücks. Wegen der niedrigen Erzeugerpreise ist die Investitionsbereitschaft in der Branche deutlich gesunken. Dabei wären Investitionen gerade jetzt wichtig, um Kosten zu sparen, wettbewerbsfähig zu bleiben, den Betrieb zu erweitern oder einen anderen zu übernehmen.
Doch viele wissen offenbar gar nicht von dem im Oktober 2015 aufgelegten deutschlandweiten Programm für Agrar-Bürgschaften. Denn so etwas gab es bis dahin nur für die gewerbliche Wirtschaft, nicht aber für Land- und Forstwirte, Fischzüchter, Weinbauern und nicht gewerbliche Gartenbaubetriebe. Die Bürgschaften erlauben im Notfall eine Absicherung von 60 Prozent der Kreditsumme und eine Verringerung der Zinskosten. Bestehende Unternehmen und Nachfolger erhalten maximal eine Million Euro Kredit, Unternehmensgründer höchstens 500000 Euro. Das Verfahren ist relativ einfach. Die Betriebe wenden sich an ihre Hausbank, die den Antrag auf eine Förderung bei der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg, der Landwirtschaftlichen Rentenbank oder, in Baden-Württemberg, auch über die L-Bank, stellt.
Zerrissen zwischen Welt- und Wochenmarkt
Kapitel 16 Zerrissen zwischen Welt- und Wochenmarkt
Kapitel 16 Zerrissen zwischen Welt- und Wochenmarkt

Bis zum Zusammenbruch der agrarischen Welt, schreibt Stadler, ist der Fleckviehgau eine Gegend von Viehzüchtern gewesen, die ihre Zuchtergebnisse bis nach Südafrika verkauften. „Davon ist nicht viel übrig geblieben.“ Die Region gelte als bedauernswertes Hinterland, das den Anschluss verpasst hat. Weil die Politik sie als strukturschwach ansehe, sei jede Investition willkommen. Alles werde dem „Arbeitsplatz-Gott zuliebe geopfert“.
Arnold Stadler preist die vergangene glückhafte Rückständigkeit des bäuerlichen Landstrichs und bedenkt die Menschen, die er einst zurückließ, mit höhnischem Spott. Spott für die Projekte der Moderne, auf die die Fleckviehgauer versuchen, ihre Zukunft zu bauen.
Stadlers Klagen über den Verlust der bäuerlichen Kultur sind ein Abbild der Probleme der Landwirtschaft in vielen Regionen Süddeutschlands. Die Bauern – und mit ihnen ihre Verbandsfunktionäre und Politiker, die Lebensmittelhändler und Verbraucher – sind zerrissen. Zerrissen zwischen den begrenzten Möglichkeiten der kleinstrukturierten Betriebe und den Anforderungen, die die globalen Lebensmärkte an die Bauern stellen. Zerrissen zwischen romantischen Vorstellungen von Bullerbü-Bauernhöfen und der Realität der modernen Agrarindustrie.




























































































































































































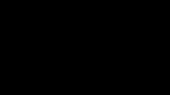
 Unsere Bauern
Unsere Bauern
 Inhalt
Inhalt
 Die große Krise
Die große Krise
 Besonders prekär
Besonders prekär
 Die Preissetzungsmacht
Die Preissetzungsmacht
 Neue Ansätze
Neue Ansätze
 Der verzagende Vorzeigebauer
Der verzagende Vorzeigebauer
 Bauer Reich und sein Hof
Bauer Reich und sein Hof
 „Es ist die definitiv übelste Phase“
„Es ist die definitiv übelste Phase“
 Video: So züchtet Ralf Reich seine Kühe
Video: So züchtet Ralf Reich seine Kühe
 Grottenfalsche Prognosen
Grottenfalsche Prognosen
 Technik verändert den Beruf
Technik verändert den Beruf
 Eigentlich keine Lust mehr
Eigentlich keine Lust mehr
 Video: Darum steigt Bauer Reich nicht auf Bio um
Video: Darum steigt Bauer Reich nicht auf Bio um
 „Oft wache ich in der Nacht auf"
„Oft wache ich in der Nacht auf"
 Wie Großkonzerne den Markt unter sich aufteilen
Wie Großkonzerne den Markt unter sich aufteilen
 Milchkrise in Wangen
Milchkrise in Wangen
 „Viele müssen mit jedem Euro rechnen“
„Viele müssen mit jedem Euro rechnen“
 Bauern und der Landschaftsschutz
Bauern und der Landschaftsschutz
 "Naschgarten" in Kressbronn
"Naschgarten" in Kressbronn
 Die „Vermaisung“ der Landschaft
Die „Vermaisung“ der Landschaft
 Ein Rind im Trend
Ein Rind im Trend
 Murnau-Werdenfelser-Rinder in 360 Grad
Murnau-Werdenfelser-Rinder in 360 Grad
 Heute dominiert Fleckvieh
Heute dominiert Fleckvieh
 Wie ein Denkmal
Wie ein Denkmal
 Dicke Luft im Schweinestall
Dicke Luft im Schweinestall
 Das sagen Schweinehalter
Das sagen Schweinehalter
 „Das Konto ist leer“
„Das Konto ist leer“
 „Der Verbraucher ist bereit“
„Der Verbraucher ist bereit“
 Den Biotrend beurteilt er skeptisch
Den Biotrend beurteilt er skeptisch
 Wut im Bauch
Wut im Bauch
 Einfache Lösungen
Einfache Lösungen
 Nebenkriegsschauplätze
Nebenkriegsschauplätze
 „Die letzten, die wir haben!“
„Die letzten, die wir haben!“
 „Einer der schönsten Berufe“
„Einer der schönsten Berufe“
 „Landwirtschaft macht Landschaft!“
„Landwirtschaft macht Landschaft!“
 Gibt es im Südwesten eine Höfesterben?
Gibt es im Südwesten eine Höfesterben?
 Auf Augenhöhe
Auf Augenhöhe
 Region, Heimat, Emotion
Region, Heimat, Emotion
 600 Vertragslandwirte
600 Vertragslandwirte
 Die Mär vom Weltmarkt
Die Mär vom Weltmarkt
 Feste Preise, feste Mengen
Feste Preise, feste Mengen
 Schafbauer Peter Mangold über seine Profession
Schafbauer Peter Mangold über seine Profession
 So schön kann Traktor fahren sein
So schön kann Traktor fahren sein
 Landwirt mit Leidenschaft für Technik
Landwirt mit Leidenschaft für Technik
 Video: So nutzt Hermann Müller Smart Farming
Video: So nutzt Hermann Müller Smart Farming
 „Smart farming“ ist in der Region noch wenig verbreitet
„Smart farming“ ist in der Region noch wenig verbreitet
 Wider die Vermaisung der Landschaft
Wider die Vermaisung der Landschaft
 Was den Böden guttut
Was den Böden guttut
 Verbesserte Bodenqualität
Verbesserte Bodenqualität
 Der Bio-Landwirt
Der Bio-Landwirt
 Der Bio-Ausweg taugt nicht für alle
Der Bio-Ausweg taugt nicht für alle
 Steigende Nachfrage nach Bio-Produkten
Steigende Nachfrage nach Bio-Produkten
 Wurst aus dem Automaten
Wurst aus dem Automaten
 Käse aus Büffelmilch
Käse aus Büffelmilch
 Champignons sorgen für Gewinn
Champignons sorgen für Gewinn
 Obst direkt an den Kunden
Obst direkt an den Kunden
 Die Meinung eines bekennenden Genießers
Die Meinung eines bekennenden Genießers
 Licht am Ende eines langen Tunnels
Licht am Ende eines langen Tunnels
 Bio- oder regionale Ware vs. Convenience-Food
Bio- oder regionale Ware vs. Convenience-Food
 Bürgschaften für Bauern
Bürgschaften für Bauern
 Bisher 30 Projekte bundesweit
Bisher 30 Projekte bundesweit
 Finanzierung mit Genussscheinen
Finanzierung mit Genussscheinen
 Zerrissen zwischen Welt- und Wochenmarkt
Zerrissen zwischen Welt- und Wochenmarkt
 Preise im Keller
Preise im Keller
 Angebot und Nachfrage entstehen global
Angebot und Nachfrage entstehen global
 Potenziale und Chancen
Potenziale und Chancen
 Impressum
Impressum