Auf dem richtigen Weg?Wie uns der Federsee vor einem Klimakollaps rettet
Experten gehen davon aus, dass jeder Hektar geschütztes Moor jährlich rund neun Tonnen CO2 einspart. In etwa so viel, wie jeder von uns im Durchschnitt jährlich verursacht.
Diese Erkenntnis dringt langsam durch. Naturschutz und Wohlstand standen über viele Jahrzehnte in einem Widerspruch zueinander - und tun es bisweilen auch heute noch.
Moore haben eine enorme ökologische Bedeutung. Wenn ihr Schutz nicht gelingt, wird Deutschland seine Klimaziele nicht erreichen, sind sich Experten einig.
Das Braunkelchen kehrt zurück
Der Singvogel mit seinem kontrastreichen Gefieder war vor rund 100 Jahren in vielen Ecken der Region zu hören.
Doch dann verstummte er vielerorts, weil sein Lebensraum schwand. Der Vogel steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten.
„ Am Federsee hat der hübsche Wiesenvogel heute sein größtes Vorkommen im Land“, erzählt der Leiter des Naturschutzzentrums Federsee in Bad Buchau, Jost Einstein.
Die Hälfte der Braunkehlchen in Baden-Württemberg brütet hier: „Ganz gegen den allgemeinen Trend ist hier die Population auf 100 bis 150 Brutpaare gewachsen.“
Ein Paradies für Tiere und Pflanzen
Mit ihren 33 Quadratkilometern ist die Landschaft das größte zusammenhängende Moorgebiet im Südwesten.
Mehr als 700 Pflanzen-, 600 Schmetterling- und 275 Vogelarten haben hier (wieder) eine Heimat gefunden.
Das Moor als Geldbringer
Vor 200 Jahren wurden große Teile des Moorgebiets für die Landwirtschaft entwässert, wie Jost Einstein erläutert.
Ein Schritt, der eine folgenschwere Kettenreaktion in Gang setzte: Denn Trocknen Moore aus, gelangt in den Untergrund Sauerstoff.
Dabei oxidiert der vorher gebundene Kohlenstoff und entweicht als Kohlendioxid (CO2) in die Atmosphäre.
„Das ist ähnlich wie bei einem Kompost. Je besser er durchlüftet ist, umso schneller zersetzt sich die organische Substanz“, sagt Einstein.
In kürzester Zeit entweichen verhältnismäßig große Mengen des klimaschädlichen Gases.
Auch für den Torfabbau wurden Moore entwässert. Im großen Stil praktizierte dies die Bevölkerung ab 1850, weil nach dem Bau der Bahnstation Schussenried der Torf besser abtransportiert werden konnte.
Lange Zeit wurde die württembergische Staatseisenbahn (Ulm – Friedrichshafen) unter anderem mit Federsee-Torf beheizt, so Einstein weiter. Bis in die 1960er-Jahre gab es Torfabbau in der Federseeregion.
Das „Moor-Schutz“-Pflänzchen wächst langsam
1911 kaufte die Nabu-Gründerin Lina Hähnle 16 Hektar Riedflächen, womit sie quasi den Grundstein legte. 1939 wurden dann 14,1 Quadratkilometer zum Naturschutzgebiet erklärt.
In den folgenden Jahren sollten weitere Flächen folgen. „Die Landwirte haben natürlich nicht ihre guten Flächen hergegeben“, sagt Einstein.
Sie hätten mit dem verkauften Land schlichtweg nichts mehr anfangen können. Denn ist der Torf einmal weg, wachse auf dem Untergrund kaum noch etwas: „Die Standfestigkeit fehlt.“
"17 Tonnen CO2 pro Hektar entweichen jedes Jahr"
„Untersuchungen des Geologischen Landesamts zeigen, dass auf den entwässerten Flächen im Federseemoor jedes Jahr fünf Millimeter Torf verloren gehen. 17 Tonnen Kohlendioxid pro Hektar entweichen so jedes Jahr in die Atmosphäre“, sagt Einstein. Die entwässerten Randbereiche des Federseemoors setzen CO2 frei, die feuchten zentralen Bereiche speichern CO2.
In wenigen Jahrzehnten sei kein Torf mehr vorhanden. Umgekehrt dauere die Bildung von einem Meter Torf etwa 1000 Jahre.
Geschichte der Menschheit konserviert
Ein wassergesättigter Torfboden konserviert sozusagen organische Substanzen wie etwa Kleidung über mehrere Tausend Jahre.
Das Federseemoor gilt als das fundreichste Moor in Europa. Immer wieder entdecken Archäologen hier Schätze aus der Jung- und Bronzesteinzeit.
EU fördert Erhalt des Federseemoors
Entwässerungsgraben wurden verschlossen und andere Maßnahmen umgesetzt, um das Wasser im Moor zu halten. Die europäische Union hat dies mit insgesamt drei Millionen Euro gefördert.
„Darüber hinaus wurden Agrar- und Umweltprogramme aufgelegt“, erläutert Einstein. Landwirte hätten sich verpflichtet, weniger zu düngen oder später zu mähen, damit die Brut durchkommt.
Dauerhaft bleibt der Torf aber nur erhalten, wenn die Flächen wieder vernässt werden.
Der Schutz ist keine Selbstverständlichkeit
„Im Rißtal befinden sich genauso Moorböden wie im Schwarzachtal oder im Tal der Ostrach“, sagt Einstein. Es sei Augenwischerei, wenn auf Böden wie diesen Intensivgrünland oder Mais für Biogasanlagen angebaut und dann von einer nachhaltigen Energieerzeugen gesprochen werde.
„Die CO2-Bilanz ist miserabel“, bekräftigt Einstein. „Das ist vergleichbar mit der Abholzung von Regenwäldern, um, dort dann Palmöl-Plantagen anzulegen. Vor unserer Haustür hätten wir es in der Hand, es besser zu machen“.
Angesprochen auf die Wiedervernässung des Ummendorfer Rieds im Landkreis Biberach sagt der Naturschützer, dass dieses Projekt ein Schritt in die richtige Richtung sei.
Jeder Einzelne ist gefragt
Natürlich einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, um der Erderwärmung etwas entgegenzusetzen, so Einstein.
Zudem sollte nur torffreie Blumenerde gekauft werden: „Auf Torf im eigenen Garten sollte jeder verzichten.“
In den regionalen Baumärkten beziehungsweise Fachgeschäften müsste zwar etwas gesucht werden, aber in der Regel hätten sie torffreie Erde im Sortiment.
Vielleicht hat das Braunkelchen so die Chance, dauerhaft in der Region heimisch werden zu können.
Impressum
Daniel Häfele, Jost Einstein
Texte
Daniel Häfele
Braunkelchen-Audio:
Michele Peron
Verantwortlich
Yannick Dillinger
Copyright
Schwäbische Zeitung 2019 - alle Rechte vorbehalten
Kontakt
www.schwaebische.de
Karlstraße 16
88212 Ravensburg
Telefon 0751 / 2955 5555
online@schwaebische.de












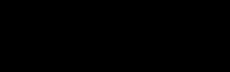











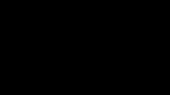
 Wie uns der Federsee vor einem Klimakollaps rettet
Wie uns der Federsee vor einem Klimakollaps rettet
 Das Braunkelchen kehrt zurück
Das Braunkelchen kehrt zurück
 Ein Paradies für Tiere und Pflanzen
Ein Paradies für Tiere und Pflanzen
 Das Federseemoor – ein gigantischer CO2-Speicher
Das Federseemoor – ein gigantischer CO2-Speicher
 Das Moor als Geldbringer
Das Moor als Geldbringer
 Das „Moor-Schutz“-Pflänzchen wächst langsam
Das „Moor-Schutz“-Pflänzchen wächst langsam
 Geschichte der Menschheit konserviert
Geschichte der Menschheit konserviert
 EU fördert Erhalt des Federseemoors
EU fördert Erhalt des Federseemoors
 Der Schutz ist keine Selbstverständlichkeit
Der Schutz ist keine Selbstverständlichkeit
 Trockenheit gefährdet das Moor
Trockenheit gefährdet das Moor
 Jeder Einzelne ist gefragt
Jeder Einzelne ist gefragt
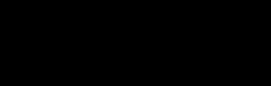 Impressum
Impressum