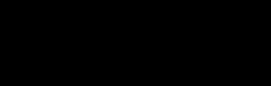Fachkräftemangel in Baden-WürttembergEine Multimedia-Reportage von Simon Müller
Im Handwerk, in der Industrie, in der Pflege: Überall sind Ausbildungsstellen unbesetzt. Fachkräfte fehlen in Deutschland an allen Ecken und Enden.
Was bedeutet das für unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand? Und wer entscheidet sich heute noch für einen Beruf im Handwerk, in der Pflege oder in der Gastronomie?
Diese Reportage sucht nach Antworten.
Was bedeutet das für unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand? Und wer entscheidet sich heute noch für einen Beruf im Handwerk, in der Pflege oder in der Gastronomie?
Diese Reportage sucht nach Antworten.
ÜbersichtKlicken Sie sich durch die sechs Kapitel unserer Multimedia-Reportage
Impressum
August 2022
Recherche, Texte und Umsetzung:
Simon Müller
Fotos:
Simon Müller, Patrick Pleul/dpa (Kapitelübersicht), Jens Büttner/dpa (Kapitel 1), Lino Mirgeler/dpa (Kapitel 1) Monika Skolimowska/dpa (Kapitel 1), Christoph Schmidt/dpa (Kapitel 1), Martin Stollberg/ Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg (Kapitel 2), Sven Hoppe/dpa (Kapitel 2), Uwe Anspach/dpa (Kapitel 2), Sebastian Gollnow/dpa (Kapitel 2), Sebastian Gollnow/dpa (Kapitel 6), Stefan Puchner/dpa (Impressum),
Videos:
Simon Müller
Schnitt:
Marcus Fey
Verantwortlich:
Michael Wollny, CvD Online-Redaktion schwaebische.de
Schwäbische Zeitung
Karlstraße 16
88212 Ravensburg
www.schwaebische.de
Recherche, Texte und Umsetzung:
Simon Müller
Fotos:
Simon Müller, Patrick Pleul/dpa (Kapitelübersicht), Jens Büttner/dpa (Kapitel 1), Lino Mirgeler/dpa (Kapitel 1) Monika Skolimowska/dpa (Kapitel 1), Christoph Schmidt/dpa (Kapitel 1), Martin Stollberg/ Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg (Kapitel 2), Sven Hoppe/dpa (Kapitel 2), Uwe Anspach/dpa (Kapitel 2), Sebastian Gollnow/dpa (Kapitel 2), Sebastian Gollnow/dpa (Kapitel 6), Stefan Puchner/dpa (Impressum),
Videos:
Simon Müller
Schnitt:
Marcus Fey
Verantwortlich:
Michael Wollny, CvD Online-Redaktion schwaebische.de
Schwäbische Zeitung
Karlstraße 16
88212 Ravensburg
www.schwaebische.de
1. Zahlen und Fakten
Zahlen und Fakten Deutschland fehlen die Fachkräfte
Die Zahl der Fachkräfte in Deutschland nimmt seit vielen Jahren deutlich ab. Das macht sich auch in unserem Alltag bemerkbar - beispielsweise wenn wir auf den Handwerker länger warten müssen oder am Flughafen in der langen Schlange vor dem Schalter stehen.
Fachkräfte fehlen in fast allen Berufsbereichen. Egal ob im Handwerk, im Handel oder in der Industrie: Branchenübergreifend entscheiden sich immer weniger Menschen, eine Ausbildung in diesen Bereichen anzufangen.
Hier ein paar statistische Eindrücke.
Fachkräfte fehlen in fast allen Berufsbereichen. Egal ob im Handwerk, im Handel oder in der Industrie: Branchenübergreifend entscheiden sich immer weniger Menschen, eine Ausbildung in diesen Bereichen anzufangen.
Hier ein paar statistische Eindrücke.
Ansicht vergrößern bzw. verkleinern
Immer weniger Auszubildende in Baden-Württemberg

Ansicht vergrößern bzw. verkleinern
Immer weniger Auszubildende in bestimmten Berufsbereichen

Ansicht vergrößern bzw. verkleinern
Immer weniger Frauen machen eine Ausbildung

Ansicht vergrößern bzw. verkleinern
Sind Fachkräfte und Auszubildende aus dem Ausland die Lösung?

Politik und Wirtschaft
Das sagt die Politik „Es gibt nicht die eine Lösung für die Fachkräftesicherung.“
Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium (Bild: Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut) nennt vor allem den demografischen Wandel als Grund für den Fachkräftemangel. Zwar gebe es derzeit in Baden-Württemberg einen Arbeitsmarkt nahe der
Vollbeschäftigung, aber die demografische Entwicklung werde absehbar
zu einem Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials und voraussichtlich auch des
Fachkräfteangebots in Baden-Württemberg führen, so Stefanie Neuffer, Sprecherin
des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums.
Dazu gehöre nach Angaben des Ministeriums beispielsweise eine Neubewertung der Digitalisierung und ihrer Auswirkungen. „Wir sollten Automatisierung und Produktivitätssteigerung durch Digitalisierung stärker als in der Vergangenheit als Ansatz zur Fachkräftesicherung begreifen“, sagt Neuffer. Auch Unternehmen müssten entsprechende Angebote machen wie flexible Arbeitszeiten, um ihre Attraktivität für Arbeits- und Fachkräfte erhöhen.
„Von zentraler Bedeutung für die Fachkräftesicherung ist und bleibt die Ausbildung und die Weiterbildung von Fachkräften“, so Neuffer. Besonders wichtig sei die Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern, die unter den Bedingungen der Corona-Pandemie leider nur eingeschränkt stattfinden konnte. „Klar ist: Es gibt nicht die eine Lösung für die Fachkräftesicherung.“
Dazu gehöre nach Angaben des Ministeriums beispielsweise eine Neubewertung der Digitalisierung und ihrer Auswirkungen. „Wir sollten Automatisierung und Produktivitätssteigerung durch Digitalisierung stärker als in der Vergangenheit als Ansatz zur Fachkräftesicherung begreifen“, sagt Neuffer. Auch Unternehmen müssten entsprechende Angebote machen wie flexible Arbeitszeiten, um ihre Attraktivität für Arbeits- und Fachkräfte erhöhen.
„Von zentraler Bedeutung für die Fachkräftesicherung ist und bleibt die Ausbildung und die Weiterbildung von Fachkräften“, so Neuffer. Besonders wichtig sei die Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern, die unter den Bedingungen der Corona-Pandemie leider nur eingeschränkt stattfinden konnte. „Klar ist: Es gibt nicht die eine Lösung für die Fachkräftesicherung.“
Das sagt die Politik„Es braucht das Zusammenwirken aller relevanten Akteure.“
Laut Wirtschaftsministerium setzt Baden-Württemberg für die
Fachkräftesicherung in diesem Jahr insgesamt 80 Millionen Euro ein. Außerdem
hat das Land vor zehn Jahren die Fachkräfteallianz Baden-Württemberg ins Leben
gerufen. „Neue Fachkräfte müssen ausgebildet werden, sie müssen studieren, sie
müssen qualifiziert werden oder sie müssen aus dem Ausland angeworben und hier
in den Arbeitsmarkt integriert werden“, erklärt Stefanie Neuffer. In der
Fachkräfteallianz treffe man dafür wichtige Abstimmung unter den verschiedenen
Partnern.
Mit den Welcome Centern unterstütze das Land die Unternehmen dabei, internationale Fachkräfte zu rekrutieren und zu integrieren. Außerdem sieht das Land seinen Teil zur Sicherung der Fachkräfte erfüllt, weil es das gesamte Schulsystem sowie die beruflichen Schulen, die Hochschulen und geförderte Kinderbetreuungsangeboten bereitstelle.
„Es braucht das Zusammenwirken aller relevanten Akteure“, sagt Neuffer. Sie sieht neben den Kammern und Verbänden vor allem die einzelnen Unternehmen in der Verantwortung. „Jede Branche und jedes Unternehmen ist selbst in der Pflicht, sich um Fachkräftenachwuchs zu kümmern, sich als attraktive Arbeitgeber aufzustellen und dafür zu sorgen, dass die eigenen Fachkräfte regelmäßig weitergebildet werden“, sagt Stefanie Neuffer.
Mit den Welcome Centern unterstütze das Land die Unternehmen dabei, internationale Fachkräfte zu rekrutieren und zu integrieren. Außerdem sieht das Land seinen Teil zur Sicherung der Fachkräfte erfüllt, weil es das gesamte Schulsystem sowie die beruflichen Schulen, die Hochschulen und geförderte Kinderbetreuungsangeboten bereitstelle.
„Es braucht das Zusammenwirken aller relevanten Akteure“, sagt Neuffer. Sie sieht neben den Kammern und Verbänden vor allem die einzelnen Unternehmen in der Verantwortung. „Jede Branche und jedes Unternehmen ist selbst in der Pflicht, sich um Fachkräftenachwuchs zu kümmern, sich als attraktive Arbeitgeber aufzustellen und dafür zu sorgen, dass die eigenen Fachkräfte regelmäßig weitergebildet werden“, sagt Stefanie Neuffer.
Das sagt die Wirtschaft„Unternehmen müssen Talenten inzwischen deutlich mehr bieten.“
Auch die großen Unternehmen in
der Region spüren den Fachkräftemangel. Für das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim
mit einem Standort in Biberach entwickelt sich der Arbeitsmarkt immer mehr zum
Bewerbermarkt. Die Rekrutierung von Fachkräften sei schwieriger geworden ist. „Unternehmen
müssen den Talenten inzwischen deutlich mehr bieten und eine größere Bandbreite
an Angeboten machen“, sagt Petra Scharmann, Sprecherin von Boehringer
Ingelheim.
Deswegen sucht das Unternehmen in vielen Bereichen nach geeigneten und qualifizierten Fachkräften. In der Forschung, der IT oder im Ingenieurswesen. „Aber auch im nicht-akademischen Bereich ist Boehringer Ingelheim auf der Suche nach qualifizierten Talenten. Beispielhaft sind hierbei Chemikanten“, so Scharmann.
Aus Sicht des Unternehmens müssen die Rahmenbedingungen stimmen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken – hier sieht man die Politik in der Pflicht. „Bezahlbarer Wohnraum, eine verlässliche Mobilität jenseits des Autos und die Kinderbetreuung sowie Infrastruktur und schnelles Internet sind wichtige Stellschrauben, an denen noch gedreht werden kann“, erklärt Scharmann.
Im Unternehmen selbst setze man seit Jahren auf Weiterbildung, um der Fachkräftelücke zu begegnen. Darüber hinaus biete Boehringer Ingelheim für Führungskräfte ein sehr breites Qualifizierungsangebot.
Deswegen sucht das Unternehmen in vielen Bereichen nach geeigneten und qualifizierten Fachkräften. In der Forschung, der IT oder im Ingenieurswesen. „Aber auch im nicht-akademischen Bereich ist Boehringer Ingelheim auf der Suche nach qualifizierten Talenten. Beispielhaft sind hierbei Chemikanten“, so Scharmann.
Aus Sicht des Unternehmens müssen die Rahmenbedingungen stimmen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken – hier sieht man die Politik in der Pflicht. „Bezahlbarer Wohnraum, eine verlässliche Mobilität jenseits des Autos und die Kinderbetreuung sowie Infrastruktur und schnelles Internet sind wichtige Stellschrauben, an denen noch gedreht werden kann“, erklärt Scharmann.
Im Unternehmen selbst setze man seit Jahren auf Weiterbildung, um der Fachkräftelücke zu begegnen. Darüber hinaus biete Boehringer Ingelheim für Führungskräfte ein sehr breites Qualifizierungsangebot.
Das sagt ein Verband„Der beste Weg, seinen Fachkräftebedarf zu sichern, ist selbst auszubilden.“
Für die Kreishandwerkerschaft Ravensburg sind die Gründe für
den Fachkräftemangel vielschichtig. Der erhöhte Fachkräftebedarf im Handwerk
erkläre sich aus der steigenden Nachfrage nach handwerklichen Leistungen und
der Altersstruktur in den Betrieben, betont Franz Moosherr, Geschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft Ravensburg.
Zwar würden junge Menschen zunehmend begreifen, dass das Handwerk zukunftsfähig sei und hervorragende berufliche Perspektiven biete, aber „wir schaffen es trotzdem nicht, alle Ausbildungsplätze im Handwerk zu besetzen. Allein im Landkreis Ravensburg bleiben jährlich mindestens 200 Ausbildungsplätze unbesetzt“, sagt Moosherr. Aber die Bewerberlage sei nicht schlechter als in den vergangenen Jahren. Moosherr erwartet sogar einen leichten Zuwachs bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen im Jahr 2022.
„Der beste Weg, seinen Fachkräftebedarf zu sichern, ist natürlich selbst auszubilden“, sagt Moosherr. Die Betriebe seien aufgerufen, den Kontakt zu den Schulen vor Ort beispielsweise durch Bildungspartnerschaften zu intensivieren. Außerdem muss das Augenmerk laut Moosherr auch verstärkt auf das Sichern der Fachkräfte gerichtet werden. „Wir leben in einem hart umkämpften Fachkräftemarkt. Die Handwerksbetriebe müssen sich hierbei als attraktive Arbeitgeber profilieren.“
Zwar würden junge Menschen zunehmend begreifen, dass das Handwerk zukunftsfähig sei und hervorragende berufliche Perspektiven biete, aber „wir schaffen es trotzdem nicht, alle Ausbildungsplätze im Handwerk zu besetzen. Allein im Landkreis Ravensburg bleiben jährlich mindestens 200 Ausbildungsplätze unbesetzt“, sagt Moosherr. Aber die Bewerberlage sei nicht schlechter als in den vergangenen Jahren. Moosherr erwartet sogar einen leichten Zuwachs bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen im Jahr 2022.
„Der beste Weg, seinen Fachkräftebedarf zu sichern, ist natürlich selbst auszubilden“, sagt Moosherr. Die Betriebe seien aufgerufen, den Kontakt zu den Schulen vor Ort beispielsweise durch Bildungspartnerschaften zu intensivieren. Außerdem muss das Augenmerk laut Moosherr auch verstärkt auf das Sichern der Fachkräfte gerichtet werden. „Wir leben in einem hart umkämpften Fachkräftemarkt. Die Handwerksbetriebe müssen sich hierbei als attraktive Arbeitgeber profilieren.“
Azubi Hotelfachfrau
HotelfachfrauDarum hat sich eine junge Frau für die Hotellerie entschieden
Junge Menschen starten immer seltener eine Ausbildung im Hotel- und Gastgewerbe. Bei der Arbeit anzupacken und mit Menschen ins Gespräch zu kommen - so scheint es - liegt bei jungen Menschen nicht sonderlich im Trend.
Für eine junge Frau aus Aulendorf
ist das ganz anders. Sie arbeitet gerne im Hotel und erzählt, warum das so ist.
Für eine junge Frau aus Aulendorf
ist das ganz anders. Sie arbeitet gerne im Hotel und erzählt, warum das so ist.
Vivienne Schweitzer
Alter: 24
Berufsausbildung: Hotelfachfrau mit Zusatzqualifikation Hotelmanagement
Ausbildungsjahr: Zweites Lehrjahr
Betrieb: Hotel Arthus in Aulendorf
Berufsausbildung: Hotelfachfrau mit Zusatzqualifikation Hotelmanagement
Ausbildungsjahr: Zweites Lehrjahr
Betrieb: Hotel Arthus in Aulendorf
Das ist ihre Geschichte
Viviennes Weg zur Ausbildung als Hotelfachfrau hatte einen
Umweg: Die ursprünglich aus Karlsruhe stammende Vivienne hat nach ihrem Abitur zunächst
zwei Jahre Jura studiert, dann aber abgebrochen. „Das war nicht so meins, ich
wollte lieber in die Hotellerie“, sagt sie.
Die Entscheidung ist ihr nicht leichtgefallen, weil auch ihre Eltern der Meinung waren, keine Ausbildung als Hotelfachfrau zu beginnen. „Aber ich bereue meine Entscheidung nicht. Ich liebe meinen Job“, sagt sie. Wegen ihres Ausbildungsbetriebs hat es sie ins oberschwäbische Aulendorf verschlagen. Das mittelalterliche Erlebnishotel Arthus gefällt ihr sehr gut zum Arbeiten.
An ihrem Job als Hotelfachfrau liebt Vivienne die tägliche Arbeit mit neuen Menschen. Jeden Tag lernt man andere Menschen aus aller Welt kennen, das sei für sie sehr abwechslungsreich. Auch die flexiblen Arbeitszeiten und die Arbeit im Team sagen ihr in der Hotellerie zu. „Viele haben einfach ein falsches Bild von unserer Arbeit. Es ist so viel mehr als nur die Drecksarbeit machen“, sagt Vivienne.
Die Entscheidung ist ihr nicht leichtgefallen, weil auch ihre Eltern der Meinung waren, keine Ausbildung als Hotelfachfrau zu beginnen. „Aber ich bereue meine Entscheidung nicht. Ich liebe meinen Job“, sagt sie. Wegen ihres Ausbildungsbetriebs hat es sie ins oberschwäbische Aulendorf verschlagen. Das mittelalterliche Erlebnishotel Arthus gefällt ihr sehr gut zum Arbeiten.
An ihrem Job als Hotelfachfrau liebt Vivienne die tägliche Arbeit mit neuen Menschen. Jeden Tag lernt man andere Menschen aus aller Welt kennen, das sei für sie sehr abwechslungsreich. Auch die flexiblen Arbeitszeiten und die Arbeit im Team sagen ihr in der Hotellerie zu. „Viele haben einfach ein falsches Bild von unserer Arbeit. Es ist so viel mehr als nur die Drecksarbeit machen“, sagt Vivienne.
VideoDas bedeutet Vivienne die Hotellerie
Die Hotellerie ist für viele junge Menschen nicht mehr attraktiv. Vivienne erzählt im Interview aber, was ihr an ihrem Beruf besonders Spaß macht, welchen Klischees sie begegnet und wie man dem Fachkräftemangel im Hotel- und Gastgewerbe entgegenwirken kann.
So sieht ein normaler Arbeitstag für Vivienne aus
18.00 Uhr: Die Spätschicht startet.
19.30 Uhr: Die Tage sind abwechslungsreich. Je nachdem, ob im Service Unterstützung gebraucht wird, hilft Vivienne beim Bedienen aus.
22.00 Uhr: Arbeit an der Rezeption. Jetzt muss Vivienne Anfragen der Hotelgäste beantworten, Umbuchungen checken oder Gäste empfangen.
1.30 Uhr: Feierabend. Ab nach Hause.
19.30 Uhr: Die Tage sind abwechslungsreich. Je nachdem, ob im Service Unterstützung gebraucht wird, hilft Vivienne beim Bedienen aus.
22.00 Uhr: Arbeit an der Rezeption. Jetzt muss Vivienne Anfragen der Hotelgäste beantworten, Umbuchungen checken oder Gäste empfangen.
1.30 Uhr: Feierabend. Ab nach Hause.
"Menschen mit meiner Dienstleistung glücklich zu machen - das erfüllt mich"Vivienne Schweitzer
Azubi Bäckerin
BäckerinDarum hat sich eine junge Frau fürs Handwerk entschieden
Junge Menschen starten immer seltener eine Ausbildung im Handwerk. Egal ob auf dem Bau, im Friseursalon oder in der Backstube. Die Arbeit scheint vielen zu mühselig.
Eine junge Frau aus dem oberschwäbischen Wolfegg
sieht das anders. Sie arbeitet gerne körperlich und ihr Handwerk erfüllt sie.
Eine junge Frau aus dem oberschwäbischen Wolfegg
sieht das anders. Sie arbeitet gerne körperlich und ihr Handwerk erfüllt sie.
Anna Grundmann
Alter: 19
Berufsausbildung: Bäckerin
Lehrjahr: seit Juli Gesellin
Ausbildungsbetrieb: Landbäckerei Heinzelmann in Wolfegg
Berufsausbildung: Bäckerin
Lehrjahr: seit Juli Gesellin
Ausbildungsbetrieb: Landbäckerei Heinzelmann in Wolfegg
Das ist ihre Geschichte
Ein Schulpraktikum bei ihrem jetzigen Ausbildungsbetrieb
hat Anna auf die Idee gebracht, das Bäckerhandwerk zu erlernen. „Es hat mir einfach
Spaß gemacht“, sagt sie. Schon vor ihrer Ausbildung half sie deshalb in der Backstube der Wolfegger Bäckerei aus. Nach der Realschule hat sie ihre
Ausbildung dort begonnen, die sie mit einem sehr guten Zeugnis abgeschlossen hat.
Ihre Berufswahl hat sie nicht bereut. „Ich bin glücklich, dass ich mich dafür entschieden habe“, sagt Anna.
Besonders gefällt ihr bei ihrer Arbeit die Abwechslung der verschiedenen Produkte – denn das Bäckerhandwerk geht mit dem weltlichen, kirchlichen und ökologischen Kreislauf des Jahres mit. „Wir backen mal Osterhasen, mal Funkenringe, mal haben wir mehr Erdbeerkuchen, dann wieder eine Phase, in der wir Zwtschgendatschi backen“, erklärt Anna.
Der frühe Arbeitsbeginn war anfangs für sie hart, mittlerweile hat sie sich daran gewöhnt. „Ich genieße es, mittags dann freizuhaben, dann kann ich da beispielsweise mit meinen Pferden ausreiten“, sagt sie. Im September beginnt Anna zusätzlich nun noch eine Ausbildung zur Konditorin, die dauert dann aber nur zwei Jahre, weil sie schon die abgeschlossene Ausbildung zur Bäckerin im Gepäck hat.
Besonders gefällt ihr bei ihrer Arbeit die Abwechslung der verschiedenen Produkte – denn das Bäckerhandwerk geht mit dem weltlichen, kirchlichen und ökologischen Kreislauf des Jahres mit. „Wir backen mal Osterhasen, mal Funkenringe, mal haben wir mehr Erdbeerkuchen, dann wieder eine Phase, in der wir Zwtschgendatschi backen“, erklärt Anna.
Der frühe Arbeitsbeginn war anfangs für sie hart, mittlerweile hat sie sich daran gewöhnt. „Ich genieße es, mittags dann freizuhaben, dann kann ich da beispielsweise mit meinen Pferden ausreiten“, sagt sie. Im September beginnt Anna zusätzlich nun noch eine Ausbildung zur Konditorin, die dauert dann aber nur zwei Jahre, weil sie schon die abgeschlossene Ausbildung zur Bäckerin im Gepäck hat.
VideoDas bedeutet Anna das Bäckerhandwerk
Das Handwerk ist für viele junge Menschen nicht mehr attraktiv. Anna erzählt im Interview aber, was ihr an ihrem Beruf als Bäckerin besonders Spaß macht, welchen Klischees sie begegnet und wie man dem Fachkräftemangel im Handwerk entgegenwirken kann.
So sieht ein normaler Arbeitstag für Anna aus
4.00 Uhr: Der Arbeitstag startet. Zuerst werden „Hörnle und
Brezeln“ gebacken, dann alle anderen Laugengebäcke. Weiter geht es mit den
Seelen und Wecken, die Anna in den Ofen schiebt. Dann beginnt sie, die ersten
Kuchen für den Verkauf fertig zu machen. Derzeit beliebt: Zwetschgendatschi.
8.00 Uhr: Pause. Zeit, um herunterzukommen oder etwas zu essen.
8.30 Uhr: Weiter geht es: Im zweiten Teil des Arbeitstages sind vor allem Süßteig-Produkte an der Reihe. Anna macht besonders Zöpfe und Nussstollen gern.
12.30 Uhr: Feierabend. Anna geht nach Hause.
8.00 Uhr: Pause. Zeit, um herunterzukommen oder etwas zu essen.
8.30 Uhr: Weiter geht es: Im zweiten Teil des Arbeitstages sind vor allem Süßteig-Produkte an der Reihe. Anna macht besonders Zöpfe und Nussstollen gern.
12.30 Uhr: Feierabend. Anna geht nach Hause.
"Einen Bürojob, das wollte ich nie machen. Ich muss schon auch körperlich etwas tun, sonst drehe ich durch."Anna Grundmann
Azubi Pflege
Darum arbeite ich in der Pflege
Viele junge Menschen können sich nicht vorstellen, eine Ausbildung in der Pflege zu beginnen. Egal ob in der Altenpflege, im Krankenhaus oder auch als Hebamme: Die Arbeit scheint vielen jungen Menschen nicht attraktiv genug.
Ein junger Mann aus Biberach
sieht das anders. Er arbeitet gerne in der Pflege und erzählt, warum ihn seine Arbeit so erfüllt.
Ein junger Mann aus Biberach
sieht das anders. Er arbeitet gerne in der Pflege und erzählt, warum ihn seine Arbeit so erfüllt.
Marcel Mientus
Alter: 23
Berufsausbildung: Gesundheits- und Krankenpfleger
Ausbildungsjahr: drittes Lehrjahr
Betrieb: Sana Klinikum in Biberach
Berufsausbildung: Gesundheits- und Krankenpfleger
Ausbildungsjahr: drittes Lehrjahr
Betrieb: Sana Klinikum in Biberach
Das ist seine Geschichte
Nach seinem Abitur hat Marcel im Sana Klinikum ein Praktikum
gemacht, weil er sich schon immer für Medizin interessiert hatte. Dem
Biberacher hat das Praktikum so gut gefallen, dass er die Ausbildung zum Krankenpfleger
anfangen und nicht Medizin studieren wollte. „Als Krankenpfleger bin ich viel
näher an den Menschen dran“, sagt Marcel.
Das Klischee, dass man in der Ausbildung als Krankenpfleger wenig verdient, stimme nicht. Die Ausbildung liege im vorderen Bereich und ist auch eine der anspruchsvollsten, meint Marcel. Gewöhnen musste er sich allerdings an den Schichtbetrieb: „Das ist schon anstrengend. Aber ich sehe auch Vorteile in flexiblen Arbeitszeiten“, sagt er. Mit Schicksalsschlägen auf Station wie dramatischen Todesfälle musste er lernen, psychisch umzugehen. Dafür werde man aber in der Ausbildung trainiert und vorbereitet.
Marcel liebt an seinem Job die Arbeit im Team und die tägliche Dynamik. „Denn jeden Tag lernt man neue Menschen, neue Schicksale kennen und muss ihnen anders helfen“, betont er.
Das Klischee, dass man in der Ausbildung als Krankenpfleger wenig verdient, stimme nicht. Die Ausbildung liege im vorderen Bereich und ist auch eine der anspruchsvollsten, meint Marcel. Gewöhnen musste er sich allerdings an den Schichtbetrieb: „Das ist schon anstrengend. Aber ich sehe auch Vorteile in flexiblen Arbeitszeiten“, sagt er. Mit Schicksalsschlägen auf Station wie dramatischen Todesfälle musste er lernen, psychisch umzugehen. Dafür werde man aber in der Ausbildung trainiert und vorbereitet.
Marcel liebt an seinem Job die Arbeit im Team und die tägliche Dynamik. „Denn jeden Tag lernt man neue Menschen, neue Schicksale kennen und muss ihnen anders helfen“, betont er.
VideoDas bedeutet Marcel die Pflege
Die Pflege ist für viele junge Menschen nicht mehr attraktiv. Marcel erzählt im Interview aber, was ihm an seinem Beruf als Krankenpfleger besonders Spaß macht, welchen Klischees er begegnet und wie man dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenwirken kann.
So sieht ein normaler Arbeitstag für Marcel aus
6.00 Uhr: Start in die Frühschicht. Nach der Dienstübergabe
schaut sich Marcel die Akten seiner Patienten für den Tag an. Dann
sortiert er die Medikamente und weckt die Patienten auf.
7.30 Uhr: Vor dem Frühstück kümmert sich Marcel um die Patienten, die Hilfe beim Aufstehen oder der Körperpflege brauchen.
9.00 Uhr: Visite mit dem Arzt. Die Bemerkungen, die Marcel über die Patienten weitergibt, sind wichtig, damit der Arzt ein klareres Bild hat. Nach der Visite werden die Medikamente richtig eingestellt.
11.00 Uhr: Nächster Kontrollgang. Jeden Tag hat Marcel andere Aufgaben – je nachdem, wie Hilfe benötigt wird.
14.00 Uhr: Dienstübergabe an die nächste Schicht. Dann ist Feierabend.
7.30 Uhr: Vor dem Frühstück kümmert sich Marcel um die Patienten, die Hilfe beim Aufstehen oder der Körperpflege brauchen.
9.00 Uhr: Visite mit dem Arzt. Die Bemerkungen, die Marcel über die Patienten weitergibt, sind wichtig, damit der Arzt ein klareres Bild hat. Nach der Visite werden die Medikamente richtig eingestellt.
11.00 Uhr: Nächster Kontrollgang. Jeden Tag hat Marcel andere Aufgaben – je nachdem, wie Hilfe benötigt wird.
14.00 Uhr: Dienstübergabe an die nächste Schicht. Dann ist Feierabend.
"Ich bin stolz darauf, einen kranken Menschen genau dann zu begleiten, wenn er am meisten Hilfe braucht."Marcel Mientus
Ökonom im Interview
Experteninterview: Was der Fachkräftemangel für Deutschland bedeutet
Experteninterview: Was der Fachkräftemangel für Deutschland bedeutet

Ökonom: „Wir brauchen langfristig mehr Fachkräfte.“

Alexander Kritikos; Bild: DIW Berlin/F. Schuh.
Vollbild
Alexander Kritikos ist Ökonom und Forschungsdirektor am
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Im Interview spricht er die verschiedenen Gründe für den aktuell akuten Fachkräftemangel in Deutschland und welche Fehler auch viele Unternehmen gemacht haben.
Er macht deutlich, was ein langfristiger Fachkräftemangel für die deutsche Wirtschaft bedeuten würde und er liefert Lösungen, wie man dem Problem des Fachkräftemangels entgegentreten kann.
In welchen Bereichen fehlen Fachkräfte in Deutschland derzeit am meisten?
Offensichtlich trifft der Fachkräftemangel derzeit die Gastronomie und den gesamten Reisebereich. Die beiden Bereiche hat es in Folge der Pandemie besonders stark getroffen. Darüber hinaus gibt es noch den Pflegebereich, in dem wir schon länger ein Fachkräfteproblem haben. Und auch im Handwerk ist es seit einiger Zeit ein Dauerbrenner-Thema, dass es an Fachkräften fehlt.
Warum sind es genau diese Bereiche, also Berufe, bei denen man eher noch anpacken muss? Wollen sich gerade die jungen Menschen ihre Finger nicht mehr schmutzig machen?
Es gibt unterschiedliche Gründe. Der Gastro- und der Tourismus-Bereich haben das Problem, dass dort vor der Pandemie zu viele Leute entlassen worden sind, die man jetzt wieder verzweifelt versucht, einzustellen. Die Leute, die vorher in diesen Bereichen tätig waren, haben inzwischen häufig andere Jobs und kommen häufig nicht mehr zurück.
Ihnen dürften die mit der Pandemie verbundenen Jobrisiken noch in den Knochen stecken. Das heißt: Jenseits der Tatsache, dass diese Jobs häufig nicht gut bezahlt waren, kam das unerwartete Entlassungsrisiko dazu. Das stärkt nicht das Vertrauen in eine dauerhafte Beschäftigung. Der Fachkräftemangel ist in diesen Bereichen also pandemiebedingt und resultiert aus meiner Sicht auch aus Fehleinschätzungen - gerade von größeren Konzernen. Die haben, wie sich im Nachhinein zeigt, zu viele Leute entlassen und jetzt einen Mangel an Beschäftigten.
Also haben sich die Unternehmen verzockt?
Verzockt trifft das nicht, aber sie haben die Lage nach der Pandemie falsch eingeschätzt. Das kann passieren. Aber wie gesagt: Viele Jobs in der Gastrobranche und manche Jobs in der Tourismusbranche sind nicht gut bezahlt. Durch Tarif- oder Lohnerhöhung könnte man solche Jobs ein Stück weiter attraktiver machen. Das gilt aber auch für die Pflege.
Also liegt es in der Pflege nur an der Bezahlung, dass sich immer weniger für einen Beruf in diesem Bereich entscheiden?
Die geringe Bezahlung ist neben der hohen körperlichen Belastung ein wesentlicher Grund.
Aber gerade in den Bereichen Pflege, Gastro und Handwerk brauchen wir doch auch weiterhin Fachkräfte?
Ich würde noch weiter gehen. Wir haben ganz grundsätzlich einen Fachkräftemangel, das ist ein strukturelles Problem. Seit mindestens 20 Jahren haben wir ein Demographieproblem, wonach mehr Menschen in Rente gehen als Menschen, die aus der in Deutschland lebenden Bevölkerung heraus in den Arbeitsmarkt eintreten. Bis 2015 ließ sich das Problem noch gut durch Zuwanderung lösen – vor allem durch Zuwanderung meist aus den damaligen Krisenstaaten in Südeuropa. Von dort ist die Zuwanderung relativ einfach geregelt, weil Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union herrscht. Viele dieser Länder haben aber mittlerweile ihren Krisenstatus verloren, weswegen von dort kaum mehr Menschen nach Deutschland einwandern.
Und die Zuwanderung aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland ist eben nach wie vor zu schwierig. Manche Unternehmen haben sich in der Phase zwischen 2015 und Pandemie dadurch beholfen, dass sie Flüchtlinge weitergebildet und in ihre Unternehmen erfolgreich integriert haben. Aber das kann das Fachkräftepotential, das wir in Deutschland haben, nicht abdecken. Die aktuell insgesamt eher mager ausfallende Zuwanderung reicht in Summe nicht für den Fachkräftebedarf in Deutschland.
Aber wären Fachkräfte nicht wichtig, um die großen Krisen wie den Klimawandel, neue Corona-Mutanten oder die Wohnungsnot zu bewältigen?
In der Tat, wir brauchen langfristig mehr Fachkräfte. Unter den verschiedenen Optionen zur Lösung des Problems dürfte mehr Zuwanderung der wichtigste Schritt sein. Ein zweiter Lösungsansatz wäre, das Rentenalter nach oben zu setzen, wofür derzeit vieles spricht. Und das dritte ist: Politik und Gesellschaft müssen sich Gedanken machen, wie mehr Frauen aus der Teilzeit- in die Vollzeitbeschäftigung geholt und insgesamt die Frauenerwerbsquote erhöht werden kann. Aber der wichtigste Ansatz ist sicherlich die Zuwanderung. Die muss aus Nicht-EU-Ländern vereinfacht werden.
Da muss die Politik aber doch möglichst bald handeln. Denn das Fachkräfteproblem spüren wir ja jetzt schon vehement.
Ja, im Prinzip sofort. Es werden erst dann mehr Menschen aus dem Ausland nach Deutschland kommen, wenn das Zuwanderungssystem vereinfacht wird. In den vergangenen Jahren ist die innereuropäische Zuwanderung sehr stark zurückgegangen. Von außerhalb Europas kommen im Jahr gerade rund 30.000 Menschen - das ist viel zu wenig.
Die Lösungen sind schlüssig, aber das Renteneintrittsalter zu erhöhen, die Zuwanderung zu erleichtern – das sind ja alles sehr unpopuläre Entscheidungen.
Es ist bedauerlich, dass in Deutschland die Entscheidung zu mehr Einwanderung immer noch als unpopulär empfunden wird. Insofern bedarf es auch der Aufklärung, dass eine besser gesteuerte Zuwanderung nicht die Probleme im Land erhöht, sondern eher zu deren Lösung beiträgt.
Was die Erhöhung des Renteneintrittsalters angeht, führt kein Weg daran vorbei. Denn wenn die Lebenserwartung steigt, müssen auch die Arbeitszeiten erhöht werden, um das Rentenniveau zu halten. Eine zielführende Lösung läge darin, dass sich die Politik Gedanken macht, wie das Renteneintrittsalter flexibler gestaltet werden kann. Man könnte beispielsweise Unterscheidungen zwischen wissensintensiven Arbeiten und körperbelastenden Arbeiten vornehmen. Gerade bei den wissensintensiven Beschäftigten kann das Rentenalter leichter erhöht werden. Der Gedanke „Arbeit ist Arbeitsleid und je früher in Rente, desto besser“ - gilt sicher nicht mehr für die wissensintensiven Berufe.
Nochmal zur Zuwanderung: Ist dafür aktuell überhaupt eine Art Markt da? Würden Menschen aus dem Ausland überhaupt kommen, um hier als Fachkräfte zu arbeiten?
Ja, das schon. Aus Indien beispielsweise könnten viele kommen, dass sieht man daran, wie viele jedes Jahr in die USA gehen, ein paar hunderttausend Inder. Das gilt in ähnlicher Form für andere asiatische Länder. Die schlichte Antwort ist, dass Deutschland attraktiver werden muss, um im Vergleich zu den Konkurrenten um die besten Köpfe mithalten zu können. Die USA und Kanada sind einfach beliebter als wir, weil sie die Zuwanderung viel offener ausgestalten und Zuwanderung beispielsweise ermöglichen, ohne dass es dafür eines bereits im Heimatland ausgestellten Anstellungsvertrages bedarf.
In Deutschland kommt man als Nicht-EU-Ausländer nur mit Anstellungsvertrag ins Land. Es gibt zwar noch eine Art Scheinlösung, wonach Zuwandernde innerhalb von sechs Monaten als qualifizierte Arbeitskraft einen Job finden muss, für diesen Zeitraum dürfen potentielle Arbeitskräfte auch ohne Arbeitsvertrag nach Deutschland einreisen. Aber das funktioniert nicht mit einer solchen Frist. Dafür bricht niemand seine Zelte im Heimatland ab oder wandert dann eben in Länder aus, die ein einfacheres Zuwanderungsrecht kennen. Da müssen wir in Deutschland einfach besser werden.
Er macht deutlich, was ein langfristiger Fachkräftemangel für die deutsche Wirtschaft bedeuten würde und er liefert Lösungen, wie man dem Problem des Fachkräftemangels entgegentreten kann.
In welchen Bereichen fehlen Fachkräfte in Deutschland derzeit am meisten?
Offensichtlich trifft der Fachkräftemangel derzeit die Gastronomie und den gesamten Reisebereich. Die beiden Bereiche hat es in Folge der Pandemie besonders stark getroffen. Darüber hinaus gibt es noch den Pflegebereich, in dem wir schon länger ein Fachkräfteproblem haben. Und auch im Handwerk ist es seit einiger Zeit ein Dauerbrenner-Thema, dass es an Fachkräften fehlt.
Warum sind es genau diese Bereiche, also Berufe, bei denen man eher noch anpacken muss? Wollen sich gerade die jungen Menschen ihre Finger nicht mehr schmutzig machen?
Es gibt unterschiedliche Gründe. Der Gastro- und der Tourismus-Bereich haben das Problem, dass dort vor der Pandemie zu viele Leute entlassen worden sind, die man jetzt wieder verzweifelt versucht, einzustellen. Die Leute, die vorher in diesen Bereichen tätig waren, haben inzwischen häufig andere Jobs und kommen häufig nicht mehr zurück.
Ihnen dürften die mit der Pandemie verbundenen Jobrisiken noch in den Knochen stecken. Das heißt: Jenseits der Tatsache, dass diese Jobs häufig nicht gut bezahlt waren, kam das unerwartete Entlassungsrisiko dazu. Das stärkt nicht das Vertrauen in eine dauerhafte Beschäftigung. Der Fachkräftemangel ist in diesen Bereichen also pandemiebedingt und resultiert aus meiner Sicht auch aus Fehleinschätzungen - gerade von größeren Konzernen. Die haben, wie sich im Nachhinein zeigt, zu viele Leute entlassen und jetzt einen Mangel an Beschäftigten.
Also haben sich die Unternehmen verzockt?
Verzockt trifft das nicht, aber sie haben die Lage nach der Pandemie falsch eingeschätzt. Das kann passieren. Aber wie gesagt: Viele Jobs in der Gastrobranche und manche Jobs in der Tourismusbranche sind nicht gut bezahlt. Durch Tarif- oder Lohnerhöhung könnte man solche Jobs ein Stück weiter attraktiver machen. Das gilt aber auch für die Pflege.
Also liegt es in der Pflege nur an der Bezahlung, dass sich immer weniger für einen Beruf in diesem Bereich entscheiden?
Die geringe Bezahlung ist neben der hohen körperlichen Belastung ein wesentlicher Grund.
Aber gerade in den Bereichen Pflege, Gastro und Handwerk brauchen wir doch auch weiterhin Fachkräfte?
Ich würde noch weiter gehen. Wir haben ganz grundsätzlich einen Fachkräftemangel, das ist ein strukturelles Problem. Seit mindestens 20 Jahren haben wir ein Demographieproblem, wonach mehr Menschen in Rente gehen als Menschen, die aus der in Deutschland lebenden Bevölkerung heraus in den Arbeitsmarkt eintreten. Bis 2015 ließ sich das Problem noch gut durch Zuwanderung lösen – vor allem durch Zuwanderung meist aus den damaligen Krisenstaaten in Südeuropa. Von dort ist die Zuwanderung relativ einfach geregelt, weil Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union herrscht. Viele dieser Länder haben aber mittlerweile ihren Krisenstatus verloren, weswegen von dort kaum mehr Menschen nach Deutschland einwandern.
Und die Zuwanderung aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland ist eben nach wie vor zu schwierig. Manche Unternehmen haben sich in der Phase zwischen 2015 und Pandemie dadurch beholfen, dass sie Flüchtlinge weitergebildet und in ihre Unternehmen erfolgreich integriert haben. Aber das kann das Fachkräftepotential, das wir in Deutschland haben, nicht abdecken. Die aktuell insgesamt eher mager ausfallende Zuwanderung reicht in Summe nicht für den Fachkräftebedarf in Deutschland.
Aber wären Fachkräfte nicht wichtig, um die großen Krisen wie den Klimawandel, neue Corona-Mutanten oder die Wohnungsnot zu bewältigen?
In der Tat, wir brauchen langfristig mehr Fachkräfte. Unter den verschiedenen Optionen zur Lösung des Problems dürfte mehr Zuwanderung der wichtigste Schritt sein. Ein zweiter Lösungsansatz wäre, das Rentenalter nach oben zu setzen, wofür derzeit vieles spricht. Und das dritte ist: Politik und Gesellschaft müssen sich Gedanken machen, wie mehr Frauen aus der Teilzeit- in die Vollzeitbeschäftigung geholt und insgesamt die Frauenerwerbsquote erhöht werden kann. Aber der wichtigste Ansatz ist sicherlich die Zuwanderung. Die muss aus Nicht-EU-Ländern vereinfacht werden.
Da muss die Politik aber doch möglichst bald handeln. Denn das Fachkräfteproblem spüren wir ja jetzt schon vehement.
Ja, im Prinzip sofort. Es werden erst dann mehr Menschen aus dem Ausland nach Deutschland kommen, wenn das Zuwanderungssystem vereinfacht wird. In den vergangenen Jahren ist die innereuropäische Zuwanderung sehr stark zurückgegangen. Von außerhalb Europas kommen im Jahr gerade rund 30.000 Menschen - das ist viel zu wenig.
Die Lösungen sind schlüssig, aber das Renteneintrittsalter zu erhöhen, die Zuwanderung zu erleichtern – das sind ja alles sehr unpopuläre Entscheidungen.
Es ist bedauerlich, dass in Deutschland die Entscheidung zu mehr Einwanderung immer noch als unpopulär empfunden wird. Insofern bedarf es auch der Aufklärung, dass eine besser gesteuerte Zuwanderung nicht die Probleme im Land erhöht, sondern eher zu deren Lösung beiträgt.
Was die Erhöhung des Renteneintrittsalters angeht, führt kein Weg daran vorbei. Denn wenn die Lebenserwartung steigt, müssen auch die Arbeitszeiten erhöht werden, um das Rentenniveau zu halten. Eine zielführende Lösung läge darin, dass sich die Politik Gedanken macht, wie das Renteneintrittsalter flexibler gestaltet werden kann. Man könnte beispielsweise Unterscheidungen zwischen wissensintensiven Arbeiten und körperbelastenden Arbeiten vornehmen. Gerade bei den wissensintensiven Beschäftigten kann das Rentenalter leichter erhöht werden. Der Gedanke „Arbeit ist Arbeitsleid und je früher in Rente, desto besser“ - gilt sicher nicht mehr für die wissensintensiven Berufe.
Nochmal zur Zuwanderung: Ist dafür aktuell überhaupt eine Art Markt da? Würden Menschen aus dem Ausland überhaupt kommen, um hier als Fachkräfte zu arbeiten?
Ja, das schon. Aus Indien beispielsweise könnten viele kommen, dass sieht man daran, wie viele jedes Jahr in die USA gehen, ein paar hunderttausend Inder. Das gilt in ähnlicher Form für andere asiatische Länder. Die schlichte Antwort ist, dass Deutschland attraktiver werden muss, um im Vergleich zu den Konkurrenten um die besten Köpfe mithalten zu können. Die USA und Kanada sind einfach beliebter als wir, weil sie die Zuwanderung viel offener ausgestalten und Zuwanderung beispielsweise ermöglichen, ohne dass es dafür eines bereits im Heimatland ausgestellten Anstellungsvertrages bedarf.
In Deutschland kommt man als Nicht-EU-Ausländer nur mit Anstellungsvertrag ins Land. Es gibt zwar noch eine Art Scheinlösung, wonach Zuwandernde innerhalb von sechs Monaten als qualifizierte Arbeitskraft einen Job finden muss, für diesen Zeitraum dürfen potentielle Arbeitskräfte auch ohne Arbeitsvertrag nach Deutschland einreisen. Aber das funktioniert nicht mit einer solchen Frist. Dafür bricht niemand seine Zelte im Heimatland ab oder wandert dann eben in Länder aus, die ein einfacheres Zuwanderungsrecht kennen. Da müssen wir in Deutschland einfach besser werden.

Alexander Kritikos; Bild: DIW Berlin/F. Schuh.
Scrollen, um weiterzulesen
Wischen, um weiterzulesen
Wischen, um Text einzublenden



















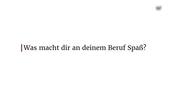














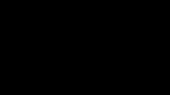
 Fachkräftemangel in Baden-Württemberg
Fachkräftemangel in Baden-Württemberg
 Übersicht
Übersicht
 Impressum
Impressum
 Deutschland fehlen die Fachkräfte
Deutschland fehlen die Fachkräfte
 Immer weniger Auszubildende in Baden-Württemberg
Immer weniger Auszubildende in Baden-Württemberg
 Immer weniger Auszubildende in bestimmten Berufsbereichen
Immer weniger Auszubildende in bestimmten Berufsbereichen
 Immer weniger Frauen machen eine Ausbildung
Immer weniger Frauen machen eine Ausbildung
 Sind Fachkräfte und Auszubildende aus dem Ausland die Lösung?
Sind Fachkräfte und Auszubildende aus dem Ausland die Lösung?
 „Es gibt nicht die eine Lösung für die Fachkräftesicherung.“
„Es gibt nicht die eine Lösung für die Fachkräftesicherung.“
 „Es braucht das Zusammenwirken aller relevanten Akteure.“
„Es braucht das Zusammenwirken aller relevanten Akteure.“
 „Unternehmen müssen Talenten inzwischen deutlich mehr bieten.“
„Unternehmen müssen Talenten inzwischen deutlich mehr bieten.“
 „Der beste Weg, seinen Fachkräftebedarf zu sichern, ist selbst auszubilden.“
„Der beste Weg, seinen Fachkräftebedarf zu sichern, ist selbst auszubilden.“
 Darum hat sich eine junge Frau für die Hotellerie entschieden
Darum hat sich eine junge Frau für die Hotellerie entschieden
 Vivienne Schweitzer
Vivienne Schweitzer
 Das ist ihre Geschichte
Das ist ihre Geschichte
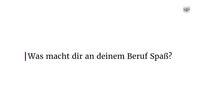 Das bedeutet Vivienne die Hotellerie
Das bedeutet Vivienne die Hotellerie
 So sieht ein normaler Arbeitstag für Vivienne aus
So sieht ein normaler Arbeitstag für Vivienne aus
 "Menschen mit meiner Dienstleistung glücklich zu machen - das erfüllt mich"
"Menschen mit meiner Dienstleistung glücklich zu machen - das erfüllt mich"
 Darum hat sich eine junge Frau fürs Handwerk entschieden
Darum hat sich eine junge Frau fürs Handwerk entschieden
 Anna Grundmann
Anna Grundmann
 Das ist ihre Geschichte
Das ist ihre Geschichte
 So sieht ein normaler Arbeitstag für Anna aus
So sieht ein normaler Arbeitstag für Anna aus
 "Einen Bürojob, das wollte ich nie machen. Ich muss schon auch körperlich etwas tun, sonst drehe ich durch."
"Einen Bürojob, das wollte ich nie machen. Ich muss schon auch körperlich etwas tun, sonst drehe ich durch."
 Darum arbeite ich in der Pflege
Darum arbeite ich in der Pflege
 Marcel Mientus
Marcel Mientus
 Das ist seine Geschichte
Das ist seine Geschichte
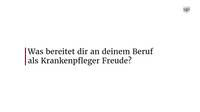 Das bedeutet Marcel die Pflege
Das bedeutet Marcel die Pflege
 So sieht ein normaler Arbeitstag für Marcel aus
So sieht ein normaler Arbeitstag für Marcel aus
 "Ich bin stolz darauf, einen kranken Menschen genau dann zu begleiten, wenn er am meisten Hilfe braucht."
"Ich bin stolz darauf, einen kranken Menschen genau dann zu begleiten, wenn er am meisten Hilfe braucht."
 Experteninterview: Was der Fachkräftemangel für Deutschland bedeutet
Experteninterview: Was der Fachkräftemangel für Deutschland bedeutet