Der Rahlenhof - Landwirtschaft mit Herzblut
Der Rahlenhof
Landwirtschaft mit Weidekühen
Artgerechte Haltung?
Das Leben einer Weidekuh
Metzger
So sieht der Beruf heute aus
Bolzenschuss
Der Tod beim Schlachter
Verbraucher
Woran ist gutes Fleisch erkennbar?
Von der Kuh bis zum Steak: Gibt es Fleisch ohne Leid?
Auf dem Rahlenhof in Ravensburg leben die Rinder auf der Weide. Der landwirtschaftliche Betrieb steht beispielhaft für viele Landwirte in der Region, die keine Massentierhaltung betreiben wollen.
Reporterin Anne Jethon war auf dem Hof und hat die Tiere von der Weide bis zur Schlachtung begleitet. Klicken Sie sich durch die Geschichte damit sie das Leben der Rinder bis zum Tod nachvollziehen können.
Landwirtschaft ein halbes Leben lang
Die Familie hat sich dazu entschieden, Landwirtschaft nach Demeter-Grundsätzen zu betreiben. Die Vorgaben des Bio-Labels sind strenger als die von herkömmlichen Bio-Betrieben.
Neben Äckern, Wiesen, Obstbäumen, Biotopen, Gewässern und Wald gehören zwei Mutterkuhherden zum Rahlenhof. Deren Fleisch macht einen wichtigen Teil der Einnahmen aus.
Die Kuh - Wie funktioniert artgerechte Haltung?
Sommer auf der Weide
Nach circa zwei Jahren werden die meisten Tiere geschlachtet – für Fleisch, das die Familie direkt vermarktet. Gemolken werden die Kühe nicht, die Milch ist bei den Schaafs nur fürs Kalb bestimmt. Die Kälber dürfen nach der Geburt bei der Mutterkuh bleiben und bis zur Schlachtung im Herdenverband leben.
Christof Schaaf kümmert sich die meiste Zeit um die Tiere. Er kennt sich mit Rindern, ihren Verhaltensweisen und ihrer Art besonders gut aus. Das ist wichtig für eine artgerechte Tierhaltung.
Weidehaltung: ein ideeller Ansatz
Klicken Sie auf den Play-Button unten, um das Video zu starten.
Jungen Kälbern werden dabei die Hörner mit einem Brennstab zerstört. Das ist für die Tiere sehr schmerzhaft, denn das Horn und die darunter liegenden Hautschichten sind gut durchblutet und mit Nerven durchzogen.
Bei Bio-Rindern ist das Ausbrennen nur in Ausnahmefällen gestattet. Christoph Schaaf lässt den Rindern ihre Hörner.
In den meisten Fällen trennen Landwirte die Kuh vom Kalb nach wenigen Wochen, damit sie die Kühe melken können.
In wenigen Bio-Höfen in der Region gibt es aber mutter- und ammengebundene Kälberaufzucht. Die Tiere werden gesäugt, die überschüssige Milch wird dann gemolken.
Auf dem Rahlenhof dürfen die Kälber bei der Mutterkuh bleiben. Denn Milch wird auf dem Hof nicht gewonnen.
Hörner
Rinder nutzen ihre Hörner zur Verständigung. Sie können damit drohen, imponieren oder ihre aktuelle Laune ausdrücken. Außerdem können sich die Tiere mit ihren Hörnern kratzen.
In vielen Betrieben werden die Hörner der Tiere gekürzt, damit sie sich nicht gegenseitig verletzen. Der Grund ist oft Platzmangel.
Jungen Kälbern werden dabei die Hörner mit einem Brennstab zerstört. Das ist für die Tiere sehr schmerzhaft, denn das Horn und die darunter liegenden Hautschichten sind gut durchblutet und mit Nerven durchzogen.
Bei Bio-Rindern ist das Ausbrennen nur in Ausnahmefällen gestattet. Christoph Schaaf lässt den Rindern ihre Hörner.
Maul
Mit ihrer rauen Zunge können die Tiere ganze Graßbüschel abreißen. Im oberen Kiefer haben sie statt Zähnen eine Kauplatte. Damit können sie ihr Futter zermahlen.
Schwanz
Mit seinem Schwanz kann ein Rind Insekten abwehren. Er ist aber auch für die Verständigung untereinander wichtig. Ob ein Rind sich unwohl fühlt oder nervös ist, erkennt man an den Schwanzbewegungen.
Augen
Die seitlich am Kopf liegenden Augen ermöglichen einen Sichtbereich von rund 330°. Rinder sehen in 3D zwar unschärfer, erkennen Bewegungen aber besser als Menschen. Daher bewegt sich Christoph Schaaf immer ruhig, damit die Tiere nicht erschrecken.
Ohren
Rinder hören besser als Menschen. Sie können genau die Richtung erkennen, aus der ein Geräusch kommt.
Euter
Im Euter einer Kuh sind zahlreiche Milchdrüsen, die Muttermilch für die Kälber produzieren. Damit sie Milch geben kann, muss eine Kuh jährlich ein Kalb zur Welt bringen.
In den meisten Fällen trennen Landwirte die Kuh vom Kalb nach wenigen Wochen, damit sie die Kühe melken können.
In wenigen Bio-Höfen in der Region gibt es aber mutter- und ammengebundene Kälberaufzucht. Die Tiere werden gesäugt, die überschüssige Milch wird dann gemolken.
Auf dem Rahlenhof dürfen die Kälber bei der Mutterkuh bleiben. Denn Milch wird auf dem Hof nicht gewonnen.
Mägen
Kühe sind Wiederkäuer und brauchen viel Zeit für die Verdauung. Sie haben insgesamt vier Mägen.
So tickt die Kuh
Rinder fressen mit Unterbrechungen bis zu zwölf Stunden am Tag. Zwischendurch legen sie sich hin, um in Ruhe wiederzukäuen. Dafür brauchen sie etwa acht bis neun Stunden. Um sich wohlzufühlen, brauchen Rinder ausreichend Platz, viel frisches Futter, viel Wasser und weiche Liegemöglichkeiten.
Sozialer Kontakt
Das Leben in der Herde ist für die Tiere besonders wichtig. Hier kennen alle Tiere einander, es gibt eine feste Rangordnung. So können sie dementsprechend Abstand halten. Gute Freunde dürfen auch näherkommen. Indem sie einander oft mit der rauen Zunge zur Fellpflege lecken, festigen die Tiere lebenslange Freundschaften.
Gemüt
Kühe sind sehr ruhige Tiere. Deshalb ist Stress nicht gut für sie.
Landwirtschaftlicher Kreislauf
Nach etwa zwei Jahren auf der Weide wird ein Rind geschlachtet. Ausgenommen sind die Mutterkühe und Stiere, die zur Zucht geeignet sind.
Henkersmahlzeit
Dabei will er das Tier von ganz alleine dazu bringen, auf den Anhänger zu gehen. Druck will er auch in den letzten Stunden eines Tieres nicht anwenden.
Der Weg zum Metzger in Waldburg ist kurz. Nur eine knappe halbe Stunde ist das Tier im Hänger unterwegs. Trotzdem ist die Fahrt ungewohnt für das Rind.
Der Schmerz nach dem Schlachten
Klicken Sie auf den Play-Button, damit Sie das Video sehen können.
Letzte Atemzüge
Das Tier auf dem Foto gehört einem anderen Landwirt. Er will das Fleisch für sich und seine Familie nutzen.
Der Bezug zum Tier
Klicken Sie dafür auf den Play-Button unten links.
Kleine Metzgereien haben es schwer
Denn den Betrieben werden viele Vorgaben gemacht, die vor allem Großbetriebe begünstigen. Sanierungen, Reparaturen, neue Geräte und das Dokumentieren vieler Arbeitsprozesse sind jetzt Vorschrift. Dafür haben die kleinen Betriebe weder die Zeit noch das Geld.
Allein während der Übergangsphase zur Umstellung auf das neue EU-Recht (2006 bis 2009) ging die Zahl der kleinen Schlachthöfe um rund ein Drittel zurück.
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) in Baden-Württemberg sieht andere Gründe für den Rückgang kleinerer Betriebe.
Unter anderem sei die Qualität des Fleisches aus größeren Schlachthöfen laufend verbessert worden (bessere Schlacht- und Kühltechnik, mehr Investitionen in den Tierschutz). Außerdem sei die Arbeit des Schlachters aufwändig und für viele Metzger unattraktiv geworden. Zudem hätten die kleinen Schlachtbetriebe Sanierungen und Reparaturen seit dem Jahr 2000 aufgeschoben. Ab diesem Jahr gingen die "Entwürfe der EU-Kommission zum Hygienepaket" in einer Stellungnahme an Verbände und Behörden raus, sagt ein Sprecher des MDL.
Wolfgang Binger sieht das aber ganz anders. Er ist wütend.
Appell an die Politik
Klicken Sie auf den Play-Button, um das Video abzuspielen.
Ausblick in die Zukunft
Immerhin: Das Land fördert einzelne landwirtschaftliche Betriebe, die durch Direktvermarktung in die Schlachtung und Verarbeitung investieren. Auch einzelne Schlachtunternehmen kann das Land fördern. Ende Juni hat Baden-Württemberg beispielsweise ein Projekt finanziell unterstützt, bei dem die Tiere in der Nähe des Hofs geschlachtet werden.
Ob diese Förderungen die Situation verbessern, bleibt abzuwarten.
Das erste Mal beim Schlachter - Können Tiere leidfrei getötet werden?
(Achtung: Teils drastische Schilderungen)Der Schritt ins UngewisseEin Erfahrungsbericht
Ich esse ungefähr einmal im Monat Fleisch vom Metzger. Deshalb will ich wissen, was hinter dem Lebensmittel steckt, das für mich schlichtweg Genuss bedeutet.
Am Hintereingang der Metzgerei empfängt mich Wolfgang Binger, Inhaber der Metzgerei. Ein freundlicher Mann, Anfang 60. Seit vielen Jahren führt er den Betrieb. Er gibt mir zusätzlich zu meinem Mundschutz Haarnetz, Plastikmantel und Schuhüberzieher. Die sind wichtig, damit ich keine Keime ins Schlachthaus trage.
Des einen Schock, des anderen Job
Den Geruch im Schlachtraum werde ich so schnell nicht vergessen. Es ist ein Gemisch aus Wurst, süßlich-metallischem Geruch und Kot.
Die Metzger häuten den Koloss. Mit präzisen Schnitten trennen sie die Haut mit dem langen Fell vom Fleisch ab. Sie ist so wenig wert, dass die Metzger froh sein müssen, wenn sie überhaupt jemand nimmt, erzählt mir Reinhold Sonntag, ein Mitarbeiter. Vor wenigen Monaten wurde das Leder noch in der Automobilbranche genutzt. Jetzt, da es dort weniger Aufträge gibt, will das Leder keiner mehr.
Immer wenn die Metzger den toten Ochsen bewegen, schwappt Blut aus seinem offenen Hals auf den Boden. Ich bin irritiert: Am ganzen Körper zucken immer noch seine Muskeln, obwohl der Kopf abgetrennt ist. "Das ist normal", sagt Reinhold Sonntag. Denn im Fleisch ist ein biologischer Stoff vorhanden, der die Zellen normalerweise mit Energie versorgt. Adenosintriphosphat kann die Muskeln noch bis zu eineinhalb Stunden nach dem Schlachten stimulieren.
Die Knochen in den Beinen werden gebrochen, dann werden die Füße abgetrennt. Das Tier wird aufgehängt, damit die Metzger besser arbeiten können. Sie schneiden den Bauch auf und holen die Innereien heraus. Die riesigen Mägen kommen in den Mülleimer, der Darm kann noch für Wurst verwertet werden. „Das Herz könnte als Hundefutter dienen“, sagt Reinhold Sonntag.
Die Metzger machen ihren Job in völliger Ruhe, stumm setzen sie Schnitt für Schnitt. Jeder Handgriff sitzt. Ich habe das Gefühl, dass sie ihre Arbeit mit Respekt und Sorgfalt machen, ohne Hektik, ohne Stress. Das nächste Tier kommt erst in einer Stunde.
Plötzlich ist der Ochse ein Stück Fleisch
Als das Tier zerlegt ist, ist der Anblick erträglicher für mich. Jetzt sieht es weniger aus wie ein Tier, sondern eher wie ein großes Stück Fleisch.
Neue Stunde, neues Tier
Der Bauer, der es gebracht hat, will das Fleisch für sich und seine Familie nutzen. Wenn das Tier getötet wird, will er dabei sein. Das Kälbchen scheint von der Fahrt gestresst zu sein. Aus seinem Maul hängen Speichelfäden. Das Tier schnuppert am Ausgang des Hängers. Es traut sich aber nicht nach draußen zu gehen. Bemerkt es den Geruch aus dem Schlachtraum?
Alles geht ganz schnell
Dann geht alles ganz schnell. Der Metzger setzt einen Bolzen auf den Kopf des Tiers, ein lauter Knall folgt. Mit einem Mal knicken die Beine des Kälbchens ein und das Tier liegt leblos am Boden. Ich erschrecke mich, halte meine Hand vor den Mund. Irgendwie war ich auf so eine schnelle Abfolge nicht vorbereitet.
Sterben durch Ausbluten
Die Metzger haben das Tier schnell und ruhig getötet, kein unnötig langes Leiden, keine vorsätzliche Tierquälerei. Und trotzdem wird mir klar: Ohne Stress stirbt ein Tier auch beim besten Metzger nicht. Denn das Tier muss weggefahren werden und kommt in eine völlig neue Umgebung, ohne seine Herde.
Der Appetit auf Fleisch ist mir erst einmal vergangen.
Trotzdem habe ich enormen Respekt vor dem Beruf des Metzgers. Vor allem, wenn er sein Handwerk richtig beherrscht und versucht, die Tiere so leidfrei wie möglich zu töten. Denn Metzger erfüllen den Wunsch der Kunden nach Fleisch, die aber von dem Töten im Hintergrund in der Regel nichts wissen wollen.
Verbraucher - Woran erkenne ich gutes Fleisch?
Woran erkennt der Verbraucher gutes Fleisch?
Ein Kriterium ist die Beschaffenheit des Fleischs: Entsteht beim Braten viel Flüssigkeit, ist das Tier wohl zu schnell gewachsen oder hatte Stress vor dem Töten. Hat das Fleisch dagegen eine Marmorierung und ist mit Fett durchzogen, hat der Landwirt dem Tier vermutlich Zeit gegeben, zu wachsen.
Außerdem will die Bundesregierung ein Tierwohlkennzeichen einführen. Der Gesetzesentwurf dafür wurde im September 2019 beschlossen. Mit dem Kennzeichen soll der Verbraucher auf der Verpackung erkennen, ob das Tier zum Beispiel viel Platz oder einen kurzen Weg zum Schlachter hatte. Das Tierwohllabel soll aber vorerst nur für Schweine eingeführt werden.
Selbst wer Fleisch mit dem Bio-Label kauft, kann sich nicht immer sicher sein, dass das Tier artgerecht gehalten wurde. Laut NABU wird auch EU-Bio-Fleisch inzwischen in Massenbetrieben erzeugt. Einige Anbauverbände zertifizieren auch Großbetriebe, zum Beispiel in der Hühner- und Eierproduktion.
Wer den Bauern kennt, bei dem er sein Fleisch kauft, kann sich am ehesten sicher sein, dass es den Tieren gut ging. Meist kann man beim Bauern das Fleisch direkt vom Hof kaufen.
Mit dieser Direktvermarktung verdient auch Christof Schaaf sein Geld. 25 Euro kostet ein Kilo Rindfleisch bei den Schaafs. Nur mit dieser Direktvermarktung kann der Bauer einen fairen Preis für sein Fleisch verlangen.
Impressum
Anne Jethon
Quellen:
Presse Deutscher Tierschutzbund
Presse Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Homepage des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft
Fotos:
Anne Jethon, dpa
Verantwortlich:
Steffi Dobmeier, stv. Chefredakteurin und Leiterin digitale Inhalte
Schwäbische Zeitung
Karlstraße 16
88212 Ravensburg
www.schwaebische.de
Copyright:
Schwäbische Zeitung 2020 - Alle Rechte vorbehalten


























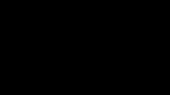
 Überblick
Überblick
 Von der Kuh bis zum Steak: Gibt es Fleisch ohne Leid?
Von der Kuh bis zum Steak: Gibt es Fleisch ohne Leid?
 Landwirtschaft ein halbes Leben lang
Landwirtschaft ein halbes Leben lang
 Sommer auf der Weide
Sommer auf der Weide
 Weidehaltung: ein ideeller Ansatz
Weidehaltung: ein ideeller Ansatz
 Das kann die Kuh
Das kann die Kuh
 So tickt die Kuh
So tickt die Kuh
 Der Landwirt gewinnt das Vertrauen der Kühe
Der Landwirt gewinnt das Vertrauen der Kühe
 Landwirtschaftlicher Kreislauf
Landwirtschaftlicher Kreislauf
 Henkersmahlzeit
Henkersmahlzeit
 Der Schmerz nach dem Schlachten
Der Schmerz nach dem Schlachten
 Letzte Atemzüge
Letzte Atemzüge
 Der Bezug zum Tier
Der Bezug zum Tier
 Kleine Metzgereien haben es schwer
Kleine Metzgereien haben es schwer
 Appell an die Politik
Appell an die Politik
 Ausblick in die Zukunft
Ausblick in die Zukunft
 Der Schritt ins Ungewisse
Der Schritt ins Ungewisse
 Des einen Schock, des anderen Job
Des einen Schock, des anderen Job
 Plötzlich ist der Ochse ein Stück Fleisch
Plötzlich ist der Ochse ein Stück Fleisch
 Neue Stunde, neues Tier
Neue Stunde, neues Tier
 Alles geht ganz schnell
Alles geht ganz schnell
 Sterben durch Ausbluten
Sterben durch Ausbluten
 Woran erkennt der Verbraucher gutes Fleisch?
Woran erkennt der Verbraucher gutes Fleisch?
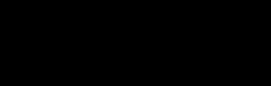 Impressum
Impressum