Hier will ich alt werden
Aufbereitet mit Bilder, Videos und Grafiken lernen Sie in diesem multimedialen Storytelling die Protagonisten und Themen noch besser kennen. Viel Spaß beim Durchklicken.
Eine Angehörige erzähltPflege daheim
Das Leben mit einem Patienten zu Hause "Ich hätte ihn nie hergegeben" Von Marlene Gempp
Das Leben mit einem Patienten zu Hause "Ich hätte ihn nie hergegeben" Von Marlene Gempp

„Er hat mich zu diesem Zeitpunkt immer mehr gebraucht“, erinnert sich Monika Dobler. „Er ist nicht mehr selbst Auto gefahren, hat Hilfe bei einfachen Dingen im Alltag gebraucht.“ Dass sie ihn zu Hause pflegen will, war ihr von Anfang an klar. „Ich mache es gern. Der Gedanke, er könne in ein Heim kommen, ist furchtbar für mich.“ Auch ihren ersten Mann pflegte sie zu Hause, als dieser früh an Krebs erkrankte und starb. Als ihre ältere Tochter dann mit Mitte 20 ebenfalls die Diagnose Krebs erhielt und nach schwerer Krankheit starb, war es für Monika Dobler wieder klar: Ich pflege meine Tochter zu Hause.
Pflege nie gelernt
Gelernt hat die Kindergärtnerin Pflege allerdings nie. Infusionen legen, Katheter spülen, füttern – vieles musste sie sich nach und nach aneignen. „Man wächst hinein. Am Anfang war ich aber schon manchmal hilflos. Nachts um 3 Uhr schnell einen Katheter spülen, weil der Partner Schmerzen hat, das ist eine ganz neue Situation“, sagt Monika Dobler.
Oft holte sie anfangs den Hausarzt oder ihre Schwägerin, eine gelernte Krankenschwester, zu Hilfe, überwindet sich, auch nachts anzurufen. Mittlerweile ist dies weniger geworden. Trotzdem ist sie immer wieder froh, über die Hilfe des Hausarztes, erzählt Monika Dobler: „Seine Unterstützung gibt mir Sicherheit und lässt mich in schwierigen Situationen nicht verzweifeln.“ Sie holt ihn oder die Sozialstation noch, wenn ihr Mann einen epileptischen Anfall bekommt. Das schafft sie nicht alleine. „Als er zum ersten Mal einen Anfall hatte, war das sehr beängstigend. Ich dachte, er stirbt“, sagt Monika Dobler. Ihr Mann war danach teilweise halbseitig gelähmt, alleine konnte sie ihn nicht heben.
Monika Dobler
Kindergärtnerin und Gemeinderätin aus Kißlegg
"Jeder Tag ist lebenwert"
Monika Dobler
pflegte bereits ihren ersten Mann und ihre Tochter zu Hause
"Ich würde ihn nie hergeben"
Monika Dobler
ist in die Pflege zu Hause hinein gewachsen
"Da komme ich an meine Grenzen"
Plötzlich 80So fühlt es sich an, alt zu sein
25-jährige Volontärin testet Alterssimulationsanzug Plötzlich 80 Von Corinna Konzett
25-jährige Volontärin testet Alterssimulationsanzug Plötzlich 80 Von Corinna Konzett


Eigentlich bin ich eine gesunde 25-Jährige. Doch mithilfe des Alterssimulationsanzug „GERT“ schlüpfe ich heute im Seniorenzentrum Carl-Joseph in Leutkirch in die Haut einer etwa 80-Jährigen. Plötzlich habe ich folgende Beschwerden: grauer Star, altersbedingte Schwerhörigkeit, Osteoporose, fehlende Feinmotorik und eine etwas lahme Zunge. Alles ganz normale Einschränkungen für einen Menschen mit 80 Jahren, erklärt mir Simone Simon, Leiterin des Seniorenzentrums. Vor etwa einem Jahr hat sich die Einrichtung den Gerontologischen Testanzug „GERT“ angeschafft. Mit diesem Simulator sollen vor allem junge Menschen dafür sensibilisiert werden, wie es sich anfühlt, alt zu sein.
Bis ich selbst 80 bin, dauert es noch 55 Jahre. Oder eben fünf Minuten, in denen mir der Alterssimulator angelegt wird. Am Oberkörper sowie an Armen und Beinen trage ich jetzt Gewichte, die insgesamt 18 Kilogramm schwer sind. Manschetten an den Knien und am Ellenbogen, Handschuhe und eine Halskrause sollen meine Beweglichkeit einschränken. Ein Gehörschutz macht mich schwerhörig und eine Brille gibt mir das Gefühl, an grauem Star zu leiden. Mein Sichtfeld ist extrem eingeschränkt, Licht fällt nur durch zwei kleine Löcher in der Brille auf meine Augen. Um etwas sehen zu können, muss ich meinen Kopf komplett in die entsprechende Richtung drehen. Zu guter Letzt gibt mir Simone Simon einen Lutscher. Den soll ich während des gesamten Experimentes im Mund behalten. „Das macht die Zunge etwas schwerer“, sagt sie. Und tatsächlich kann ich zu Beginn noch nicht einmal meinen Namen fehlerfrei aussprechen. Doch an das Hindernis im Mund gewöhne ich mich schnell. Andere Dinge fallen mir schwerer. Beim Gehen schwanke ich extrem, jeder Schritt fällt mir schwer. Schon nach wenigen Metern schwitze ich.

So stärkt Sport den ZusammenhaltSport für Jung und Alt
Deutsches Sportabzeichen: Ansporn für Generationen „Wir sind wie eine große Familie“ Von Gisela Sgier
Deutsches Sportabzeichen: Ansporn für Generationen „Wir sind wie eine große Familie“ Von Gisela Sgier


Beim Deutschen Sportabzeichen darf jeder mitmachen, egal ob Alt oder Jung. Im vergangenen Jahr wurden in Leutkirch zahlreiche Kinder, 32 Jugendliche sowie 63 Erwachsene im Alter zwischen sieben und 88 Jahren für ihren Fleiß geehrt. Belohnt wurden die Sportler mit den Abzeichen Gold, Silber und Bronze. Gleichzeitig beteiligten sich sieben Familien. Diese erhielten für ihre Anstrengungen jeweils das Familiensportabzeichen. Als Voraussetzung dafür gilt, dass sich mindestens drei Teilnehmer aus zwei Generationen daran beteiligen. „Es ist einfach immer wieder nett, wenn gesamte Familien zum Sportplatz kommen, denn dann geht es hier recht familiär zu“, sagt Matthias Rotzler, Abteilungsleiter der TSG Leutkirch. Der Sport solle dazu beitragen, über die Generationen hinweg den Zusammenhalt zu stärken und Verständnis für die Stärken und Schwächen der Altersgruppen zu entwickeln.
Rotzler würde es begrüßen, wenn die Disziplinen älteren Sportlerinnen und Sportlern altersgerecht angepasst seien. „Die Ziele müssen einfach so gesteckt sein, damit sie auch erreicht werden können“, so Rotzler. Kinder würden überwiegend am Sportabzeichen durch den Ansporn der Eltern teilnehmen. Jugendliche meldeten sich demnach meistens in Cliquen, um ihren Leistungsstand zu prüfen. Ältere Menschen würden kommen, um nicht nur dabei sein zu können sondern ebenfalls zu erfahren, wie es um ihre Fitness steht, so der Abteilungsleiter. Er betont: „Es ist einfach faszinierend immer wieder anzusehen, wie alle gemeinsam üben.“
Ähnlich sieht das Roswitha Maischberger von der TSG-Abteilung Leichtathletik, die die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens leitet: „Ich finde es einfach toll, dass es die Möglichkeit gibt, gemeinsam Sport zu machen. Wir sind hier wie eine große Familie.“ Zusammenkommen die Sportler jeglicher Altersstufe über den ganzen Sommer hinweg im Neuen Stadion, im Leutkircher Freibad, auf der Nordic-Walkingstrecke um den Stadtweiher sowie auf dem Fahrradkurs bei Heggelbach. Die erforderlichen Leistungen orientieren sich stets an den motorischen Grundfähigkeiten wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Dabei sind die Vorgaben nach Altersstufen, Geschlecht und Leistungsklassen gestaffelt und in einer Tabelle festgelegt.

Im Interview Vorleser, Seelentröster, Handtaschenfinder
Ein Lehrer erzählt Über das wenig angesehene Berufsbild des Altenpflegers Von Bernd Treffler
Ein Lehrer erzählt Über das wenig angesehene Berufsbild des Altenpflegers Von Bernd Treffler


Herr Ebel, Sie und Ihre Kollegen bilden die Altenpfleger und Altenpflegerinnen von morgen aus, damit die zunehmende Zahl von Pflegebedürftigen auch in Zukunft fachgerecht versorgt werden kann. Welchen Eindruck haben Sie von den Schülern?
Thomas Ebel: Die Schülerschaft ist interessiert und hochmotiviert, alten Leuten zu helfen. Der Bedarf an Fachkräften ist zudem hoch, unser Schwarzes Brett hängt voller Stellenanzeigen, die Abschlussschüler haben in der Regel sofort eine Stelle. Die Kurse sind voll oder gut belegt, wir sind mit fast 100 Schülern aktuell größter Standort unseres Instituts für soziale Berufe, das macht mich auch ein bisschen stolz.
Was macht einen Beruf in der Altenpflege Ihrer Meinung nach attraktiv?
Man lernt die professionelle Pflege von alten Menschen, kann mit ihnen den Alltag teilen, ihnen helfen und sie beraten. In der Altenpflege gibt es gute Möglichkeiten für Teilzeit und den Wiedereinstieg in den Beruf, man ist geografisch nicht gebunden, kann auch in vielen Berufsfeldern arbeiten: ambulant, stationär, beispielsweise in der Rehabilitation, in der Psychiatrie oder Geriatrie im Krankenhaus. Der Beruf ist abwechslungsreich, jeder Tag ist anders.
Hört sich gut an, wenn da nicht die schlechte Bezahlung wäre...
Das stimmt, Altenpfleger werden mit einem Einstiegsgehalt im öffentlichen Dienst von etwa 2700 bis 2800 Euro brutto vergleichsweise schlecht bezahlt. Das ist nicht angemessen, bei der hohen Verantwortung der Fachkräfte und für das, was sie leisten. Wobei: In der Ausbildung werden die Altenpfleger mit einem Gehalt zwischen rund 900 und 1100 Euro gut vergütet. Das ist vielleicht auch ein Ausgleich dafür, dass die Schüler hier schon stark in den Pflegealltag einbezogen werden und so einen Vorgeschmack auf den späteren Berufsalltag bekommen.
Zu diesem Alltag gehört wohl auch der oft zitierte Stress...
Die körperliche und psychische Belastung ist hoch. Dazu kommen Nachtschichten, Sonn- und Feiertagsdienste, die Rahmenbedingungen insgesamt sind eher schwierig.
Können Sie dies präzisieren?
Die Arbeit an sich ist sehr belastend, die Pflegekräfte sind für viele Bewohner zuständig, mit Krankheitsbildern, die einen erhöhten Aufwand mit sich bringen. Ein Anteil von über 50 Prozent Demenzkranker ist keine Ausnahme, sondern die Regel. Das Sozialpflegerische kommt zu kurz, es bleibt zu wenig Zeit für Gespräche und fürs Zuhören. Darunter leiden nicht nur ausgebildete Fachkräfte, sondern auch die Schüler. Sie bekommen eine schlechtes Gewissen, weil sie engagiert arbeiten, aber oft nur das sehen, was sie nicht erreicht haben. Pflegekräfte müssen häufig an die Grenze der Belastbarkeit gehen, entsprechend hoch ist der Krankenstand. Das hat zur Folge, dass man für Kollegen oft einspringen und auch in der Ausbildung unvorhergesehene Vertretungen übernehmen muss. Dazu kommen die langen Dienstphasen mit bis zu zwölf Tagen am Stück, da kommt man im Schnitt auf eine Sechs-Tage-Woche.
Es heißt, dass viele Fachkräfte, auch aus Frust über die Bedingungen, nach wenigen Jahren raus aus dem Job gehen oder sich in Teilzeit flüchten. Wie sieht das während der Ausbildung aus?
Die allermeisten ziehen die Ausbildung durch. Die Abbrecherquote ist ganz gering, weil die Motivation, alten Menschen zu helfen, hoch ist. Wir raten aber den Schülern, dass sie versuchen sollen, die wichtigsten Punkte, die sie bei uns lernen, in den Berufsalltag mit seinem ganzen Zeitdruck reinzubringen und den Blick darauf zu richten, was gelingt. Wir schauen auch insgesamt, dass die Schüler nicht über Gebühr rangenommen werden, wir schreiten da gegebenenfalls ein. Wir sehen aber schon mit Sorge, dass sie schon sehr früh in die Verantwortung reingenommen werden.
Gab es Fälle, wo Schüler in der Praxisausbildung ausgenutzt wurden?
Es gibt Heime im Kreis, mit denen wir nicht mehr zusammenarbeiten, weil die Erfahrungen so schlecht waren. Ein Beispiel ist der frühere Sonnenhof in Wangen.
Wie kann man den Pflegeberuf attraktiver machen?
Es müsste mehr Geld ins System fließen, auch durch höhere Beiträge für die Pflegeversicherung. Dem Steuerzahler, der Gesellschaft, muss die Pflege mehr wert sein. Auch die behandlungspflegerischen Leistungen in den stationären Einrichtungen müssten von den Krankenkassen voll refinanziert werden. Das zusätzliche Geld müsste natürlich in mehr Personal und eine höhere Bezahlung fließen. Die Folgen wären eine niedrigere Belastung für die Pflegekräfte, damit ein attraktiveres Berufsbild, ein besseres Ansehen des Berufs.
Welches Ansehen hat denn der Pflegeberuf derzeit?
In der öffentlichen Meinung reduziert sich der Beruf nur auf das Saubermachen oder das Anziehen alter Menschen. Es wird nicht gesehen und auch nicht wertgeschätzt, welche hohe pflegerische Leistung dahinter steckt. Wir versuchen unseren Schülern ein entsprechendes Selbstbewusstsein mitzugeben, denn die Fähigkeiten, die sie nach der Ausbildung können, sind etwas ganz Besonderes. Im Unterricht sollten die Schüler mal den Satz „Als Altenpfleger sind wir...“ vollenden, und da kamen dann auch Begriffe wie Seelentröster, Sterbebegleiter, Animateur, Vorleser, Teil der Familie, Modeberater oder Handtaschenfinder.
Alles spricht vom „Pflegenotstand“, dem Deutschland immer mehr entgegensteuert. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die 8000 Stellen, die die neue Bundesregierung in der Pflege schaffen will?
Ganz ehrlich: Das ist ein Witz. Bei 13 000 Pflegeheimen in Deutschland würden im Schnitt auf jedes Heim 0,6 Stellen fallen. Die Ankündigung der neuen Regierung ist eine Beruhigungspille, ein Tropfen auf den heißen Stein. Diese 8000 Leute gibt es zudem auf dem Markt aktuell gar nicht, viele Einrichtungen suchen derzeit händeringend nach Personal. Ob die ab 2020 von der Politik geplante generalistische Ausbildung, die auf alle drei Pflegebereiche vorbereitet, an dem personellen Engpass groß etwas ändern wird, wage ich zu bezweifeln. Bundesweit fehlen derzeit 50 000 Stellen. Und wenn nichts passiert, dann werden es 2030 wegen der Bevölkerungsentwicklung 100 000 fehlende Stellen sein. Da wirken diese 8000 Stellen noch einmal mickriger als sie es eh schon sind.

Der ADAC informiertAutonomes Fahren im Alter
Autos mit Fahrassistenz „Die Technik fällt nicht aus, Sie fallen aus“ Von Liane Sprenger
Autos mit Fahrassistenz „Die Technik fällt nicht aus, Sie fallen aus“ Von Liane Sprenger

Warum ist autonomes Fahren in aller Munde? Die Anzahl der Autounfälle sei Grund für diese Innovation, so Belz. Es gebe drei Faktoren, die die Unfallzahlen verändern können: die Straßen, der Autofahrer und das Fahrzeug. Dazu sagte der Experte: „Straßen sind teuer und nur bedingt wirkungsstark, die Konzentration oder die Psyche des Fahrers ist kaum beeinflussbar, deswegen das Fahrzeug.“
In 20 Jahren sind die Fahrer weg
Weiter erklärte Belz, auf welcher Stufe man sich bei der Innovation „Autonomes Fahren“ befinde und welche noch bevorstehen: „Wir haben Autos im Straßenverkehr, bei denen der Fahrer nur noch bedingt das Auge dem Straßenverkehr widmen muss. Die Stufe ,Augen weg’ ist erreicht. Über ,Gehirn weg’ sind wir in circa 20 Jahren bei ,Fahrer weg’“.
Die Einparkhilfe repräsentiere die erreichte Stufe. Durch Ultraschall und Radarsensoren lenken die Systeme die Autos eigenständig in Parkbuchten. Das Vertrauen der Menschen in diese Technologie fehle noch. „Keine zwei Prozent der Parkassistenzsysteme in Autos werden genutzt. Man traut sich nicht, das Lenkrad loszulassen“, so Belz. Die Frage „Was, wenn die Technik ausfällt?“, beantwortet der ADAC-Mann mit klaren Worten: „Die Technik fällt nicht aus, Sie fallen aus.“
„Assistenten“ regeln fast alles
Vier Dinge brauchen Fahrassistenzsysteme laut Belz: Die Abstandregelung (ACC/ADR) hält durch automatisches Bremsen und Beschleunigen einen definierten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ein. Die Notbremsassistenz leitet in kritischen Auffahrsituationen nach einer Fahrerwarnung eine Vollbremsung ein. Der Spurhalteassistent warnt beim Überfahren von Fahrbahnrandmarkierungen oder der Mittellinie. Teilweise erfolgt zusätzlich eine Lenkkorrektur. Der Spurwechselassistent erkennt per Radarsensorik beim Überholen, wenn sich ein nachfolgendes Fahrzeug auf versetzter Spur kritisch annähert. Er warnt den Fahrer durch Warnlichter am Außenspiegel oder einen Warnton bei gesetztem Blinker vor dem Ausscheren. Die Erkennung von Verkehrsschildern oder der Lichtassistent, der nachts automatisch das Fernlicht einschaltet und dieses entsprechend abblendet, seien die Schmankerl unter den Fahrassistenzsystemen, so Belz.
Wetter ist Risikofaktor
Der einzige Faktor, der ein Fahrassistenzsystem außer Kontrolle bringen könne, sei das Wetter. Schneefall und Eis an den Radarsensoren und Kameras setzen diese außer Funktion. Weitere Probleme täten sich ethisch, rechtlich und auf Ebene des Datenschutzes auf. „Wenn wirklich mal was passiert, haftet der Autobauer oder die Versicherung? Entscheidet sich das Auto in einer Gefahrensituation, eher den 80-Jährigen umzufahren als den Achtjährigen? Wollen wir komplett überwacht sein?“, sind Fragen, die Belz in den Raum stellt.
Autonomes Fahren kommt schneller als gedacht
Welches Auto für Senioren am besten geeignet ist, zeige ein Testergebnis. Verschiedene Fahrzeuge wurden auf die Kriterien Übersichtlichkeit, Ein- und Ausstieg, Bedienen, Nachtfahren, Komfort, Ausstattung und Kofferraum getestet. Sieger ist demnach der VW Sharan, gefolgt vom BMW 3er GF und dem VW Golf Plus. Egal welche Marke, in einem Punkt ist sich Belz sicher: Das autonome Fahrzeug wird schneller den Markt erobern als gedacht.
Angebot der Volkshochschule LeutkirchMit Kursen gegen die Einsamkeit
Angebot der VHS Leutkirch „Wir sind auch ein Anti-Vereinsamungs-Institut“ Von Herbert Beck
Angebot der VHS Leutkirch „Wir sind auch ein Anti-Vereinsamungs-Institut“ Von Herbert Beck

„Bildung, Kultur, Bewegung“ gegen Depression
Wie entsteht Einsamkeit? Eine Ursache kann der Verlust des Partners sein. Auch Familienbande existieren nicht mehr in dem Umfang wie früher. Alarm hat zuletzt aber auch der Gehirnforscher Manfred Spitzer geschlagen, der in der zunehmenden Digitalisierung eine Ursache für Unzufriedenheit oder für Depressionen sieht. „Bildung, Kultur, Bewegung“ – auf diesen drei Säulen baut Maucher mit seiner VHS auf, und das seit Jahren. Er gibt zwar zu, dass der Schnitt seiner Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer eher schon der reiferen und älteren Generation angehört. Dezidiert eine Ü-55-Sparte ausweisen will er aber nicht. „Natürlich beobachten wir die demografische Entwicklung“, erklärt Maucher. Die VHS wolle deshalb den Übergang vom Erwerbsleben in eine selbstbestimmte Gestaltung des Ruhestandes sinnvoll und attraktiv begleiten. Maucher spricht in diesem Zusammenhang von den Strukturen, die einen Tagesablauf unterstützten. Feste Termine durch Kurse oder durch Exkursionen seien eine Option, „dass sich die Menschen fit halten“, dass geistige und körperliche Frische gefördert werden. Die Altersforschung beschreibt diese Notwendigkeit seit Jahrzehnten.
Kreativität und Trends
Maucher legt deshalb mit seinem Team großen Wert darauf, dass die Angebote auch dazu beitragen können, „sich kreativ auszuleben“. Beim Kochen, beim Turnen, beim Meditieren oder auch bei Sprachkursen. Auch neuartige Trends im Gesundheitssport will die VHS aufgreifen „zu vertretbaren Preisen“. Die Möglichkeit zur Begegnung auch über Altersgruppen hinweg sieht Maucher als Klammer vieler Kurse. Daraus entstanden sind in der Vergangenheit Gruppen, die fest zusammenhalten und zu den Dauerbuchern zählen.
Aktiv gegen Vereinsamung
Ein wichtiges Element kann die VHS aber auch für Dozenten sein, die ihre Erfahrung, teils parallel zu ihrem Berufsleben, teils nach dem Eintritt in den Ruhestand, über die VHS weitergeben. Überrannt wird die Einrichtung von Neuanfragen aber nicht, obwohl durchaus Bedarf in den fünf Arbeitsbereichen vorhanden ist. Dazu kommen noch die kulturellen Angebote, die ebenfalls dazu beitragen können, sich aktiv gegen eine drohende Vereinsamung zu stemmen. „Wir wollen unsere Angebote im Bildungsbereich weiterentwickeln und ausbauen. Dabei gilt es, den Spagat zwischen Trends, Traditionen und wichtigen Themen der Zeit, eine zunehmende Flexibilität und Individualität der Gesellschaft zu beachten“, schreibt dazu Matthias Hufschmid, der stellvertretende VHS-Leiter, im Vorwort zum aktuellen Kursprogramm.
„Facebook“ und „WhatsApp“ Seminare
Das können ein Babysitterkurs, Fahrradschrauberkurse für Frauen, Männer und Jugendliche, Zumba-Fitness am Stadtweiher oder aber auch das breite Angebot an Sprachkursen sein. Stark am Berufsleben orientieren sich Kurse aus dem Bereich der EDV. Hochaktuell aber sind Einsteigerseminare zu „WhatsApp“ oder „Facebook“. Bei Letzterem heißt es in der Kursbeschreibung: „Werden Sie coole Großeltern und lassen Sie sich über Facebook aufklären.“ Risiken und Nebenwirkungen dieser Kommunikationsform sollen nicht ausgeblendet werden. Manfred Spitzer jedenfalls warnt vor zu großer Fortschrittsgläubigkeit. Im Zusammenhang mit dem von ihm erkannten Krankheitsbild der „Facebook-Depression“ will er herausgefunden haben, wer Online-Medien mehr als zwei Stunden täglich nutze, bei dem bestehe die doppelte Wahrscheinlichkeit, sich einsam zu fühlen, als bei jemandem, der nur eine halbe Stunde diese Kommunikationstechniken einsetze.
Ein Tablet-Test im AlltagSenioren lernen Skypen
Die fremde Welt des Internets Senioren-Skypen@Amtzell.de Von Claudia Bischofberger
Die fremde Welt des Internets Senioren-Skypen@Amtzell.de Von Claudia Bischofberger


Die Studie, die von der Universität Göttingen entwickelt und in Zusammenarbeit mit der Stiftung Liebenau durchgeführt wurde, sollte älteren Menschen helfen, das Leben ein wenig leichter zu machen. Gertrud Rogg nahm ebenfalls an dem Versuch teil und sie erzählt von den Begebenheiten während dieser Zeit. Auch wenn sie schon Erfahrung mit der Arbeit am PC hat. Doch durch ihre langjährige Arbeit auf dem Amt, kannte sie Menschen, die für den Test in Frage kämen. Von 32 angefragten Personen über 70 Jahre alt, blieben zum Schluss sechs übrig, die auch tatsächlich teilnahmen. „Viele fürchteten sich vor der „fremden Welt“, andere wiederum wohnten so weit außerhalb, dass es schlichtweg unmöglich war einen Internetanschluss zu bekommen“, erzählt sie. Rogg nahm teil, auch um den Menschen im Versuch besser helfen zu können.
Die Probanden hatten nun die Möglichkeit ihren Bedarf an Lebensmitteln über das Internet zu bestellen. Auf einer speziellen Maske konnten sie das Benötigte aufschreiben. Sogar eine Kamera war integriert. Damit konnten sie zum Beispiel die zur Neige gehende Packung Reis fotografieren, um genau dasselbe Produkt wieder zu erhalten. Aufgeschrieben oder abfotografiert wurde die Liste dann sogleich an den teilnehmenden Lebensmittelhändler übermittelt. Ein rüstiger Rentner brachte dann einmal pro Woche die gewünschte Ware zu den alten Menschen. „Diese Einrichtung wäre sicher sehr hilfreich für Menschen, die schlecht zu Fuß sind oder krank. Egal ob vorübergehend oder dauerhaft nicht mobil,“ vermutet Rogg. Aber einkaufen sei auch die Pflege von sozialen Kontakten.
Diese Bedenken hätten einige der befragten Personen auch gehabt, sagt Rogg. Menschen begegnen, reden, austauschen. Dafür wollen gerade die oft vereinsamten Leute manch schweren und mühsamen Weg auf sich nehmen.
Aus Schüchternheit nicht mit Bürgermeister geskypt
Mit dem Tablet hatten die Teilnehmer auch die Möglichkeit ihre Termine zu notieren oder Adressen elektronisch zu speichern. Dass Sätze wie „wo habe ich denn wieder die Nummer hingelegt...“ , würden der Vergangenheit angehören. Um die die neuesten Nachrichten aus der Gemeinde zu erfahren, gab es eine Verbindung zum Rathaus. „Sogar eine „Skypeline“ zum Bürgermeister, jedoch waren dazu die meisten etwas zu schüchtern gewesen“, meint Rogg. „Dass man beim Skypen auch von seinem Gegenüber gesehen wird, ist einer älteren Dame erst eingefallen, als sie schon den Kontakt zu einem Herrn der Stiftung Liebenau hergestellt hatte.“ Bei dieser Erinnerung muss Getrud Rogg lächeln, denn da sei es schon zu spät gewesen, die Lockenwickler aus dem Haar zu nehmen und aus dem Schlafanzug zu schlüpfen. Schließlich hätten es beide Teilnehmer mit Humor genommen, denn selbst im Internet ist menscheln erlaubt.
Gertrud Rogg ist sich sicher: „Die Menschen, die heute über 70 sind, sind sehr skeptisch gegenüber dem Internet, da sie einfach noch kaum Gelegenheit hatten damit umzugehen. Jedoch, diejenigen, die in vielleicht zehn oder 20 Jahren so weit sind, werden schon sehr viel mehr Erfahrung im Umgang mit Computer mit ins Alter nehmen.“ Und vielleicht stellt sich dann dieser Test einmal mehr als wertvoll heraus.
Das Projekt in Amtzell wurde drei Jahre lang vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gelte nun laut einem Vertreter der Stiftung Liebenau als abgeschlossen. Jedoch gebe es von der Gemeinde selber bereits Ansätze für Projekte in Sachen Mobilität für Senioren. Weitere Berichterstatung über dieser Projekte folgt.

Ambulante PflegeNeue Tagespflege Carl-Joseph kommt bisher gut an
Tagespflege Carl-Joseph in Leutkirch „Das ist wie Medizin für mich“ Von Corinna Konzett
Tagespflege Carl-Joseph in Leutkirch „Das ist wie Medizin für mich“ Von Corinna Konzett


„Die Plätze in der Tagespflege sind sehr beliebt. Ich finde, das zeigt, dass in Leutkirch ein großer Bedarf an so einem Modell da ist“, sagt Claudia Hartmann, Regionalleiterin Vinzenz von Paul für die Region Allgäu. In der Leutkircher Tagespflege können seit Februar täglich bis zu 16 Menschen den ganzen Tag, oder für einige Stunden betreut werden. „Wir wollen mit den Gästen den Alltag sinnvoll und aktiv gestalten. Jeder darf und soll seine eigenen Fähigkeiten und Interesse ausleben können“, sagt Vanessa Höger, Leiterin der Tagespflege. Wer zum Beispiel gerne kocht, kann bei der Zubereitung des Essens helfen. So sitzen gleich mehrere Senioren um den Tisch und schneiden Paprika, Gurken und Tomaten. „Da schmeckt es doch gleich besser, wenn man auch selbst mitgeholfen hat“, sagt Cäcilia Fischer, während sie eine Tomate in kleine Würfel schneidet.Wenige Minuten später versammeln sich alle wieder um den Tisch. Dieses Mal, um sich das frisch gekochte Essen schmecken zu lassen. Neben Cäcilia Fischer sitzt ein 78-Jähriger. Er reibt sich nervös die Hände und versucht vom Tisch aufzustehen. Er starrt auf seine Suppe, dann auf das Besteck, greift schließlich zur Gabel und beginnt damit die Suppe zu löffeln. Sichtlich irritiert bitten seine Nebensitzerinnen um Hilfe. „Mit dem Löffel geht es besser“, sagt Anke Rudloff, Präsenzkraft für Hauswirtschaft und Pflege, und gibt ihm behutsam den Löffel in die Hand.
Besondere Herausforderungen
„Die Tagespflege ist etwas ganz Besonderes, natürlich auch mit besonderen Herausforderungen“, sagt Höger. So seien in ihrer Einrichtung viele verschiedene Menschen mit den unterschiedlichsten Krankheiten und Einschränkungen zu Gast. „Unsere Aufgabe ist es die Gruppendynamik so zu steuern, dass sich trotz den Unterschieden alle wohlfühlen“, erklärt sie. Mit dem Angebot soll nicht nur den Menschen mit Pflegebedarf geholfen werden. „Ganz wichtig ist für uns auch die Entlastung der pflegenden Angehörigen“, erklärt die Leiterin. Die Angehörigen seien oft schon für wenige Stunden dankbar, in denen sie sich um sich selbst kümmern könnten.
Lebensfreude wiedergefunden
Während sich die meisten Tagespflegegäste nach dem Essen ausruhen, kommt Erika Gischa erst jetzt dazu. Sie besucht die Einrichtung nur nachmittags. Freudig begrüßt sie alle Anwesenden und kommt mit jedem sofort ins Gespräch. „Man kennt sich halt“, sagt die 83-Jährige und lächelt. Sie war lange ehrenamtlich aktiv und hat früher unter anderem Besuchsdienste im Seniorenzentrum Carl-Joseph geleistet. „Dass ich jetzt selbst ein Angebot bei Carl-Joseph wahrnehme, ist wie heimkommen“, erzählt die Leutkircherin. Sie habe einige Jahre ihren kranken Ehemann zuhause gepflegt. Dieser sei dann plötzlich verstorben. Nur kurze Zeit später der nächste Schicksalsschlag: Erika Gischa bekommt einen Schlaganfall. „Von einer Sekunde auf die andere war mein ganzes Leben anders“, erinnert sich die Seniorin, „Ich musste mit meinen Ehrenämtern aufhören und mich komplett neu sortieren.“ Das Angebot der Tagespflege habe ihr dabei geholfen. Die Stunden, die sie dort verbringt, empfinde sie jedes Mal als sehr wertvoll. „Sonst wäre ich alleine zuhause, hier sitze ich mit vielen anderen am Tisch, kann singen, basteln oder einfach schwätzen“, sagt die 83-Jährige, „Das hier ist die beste Medizin für mich - sogar ohne Nebenwirkungen.“
Jeden Dienstag bekommen die Tagespflegegäste Besuch: Eine Dame spielt Tischharfe und singt mit den Senioren. Passend zum Wetter werden an diesem Dienstag Frühlingslieder gesungen: „Horch was kommt von draußen rein: Hola hi - Hola ho“. Auch der 78-jährige Mann singt mit. Noch vor wenigen Stunden wollte er seine Suppe mit einer Gabel essen, jetzt singt er aus voller Kehle. Als einziger kennt er alle Lieder, die heute gesungen werden, auswendig und wirft keinen einzigen Blick in das Gesangbuch.

Mehr Mobilität im AlltagEin Rollatorenparcours für Amtzell
Mit dem Rollator am Leben teilnehmen Von Marlene Gempp
Mit dem Rollator am Leben teilnehmen Von Marlene Gempp


Vom Haus St. Gebhard aus Richtung Lourdesgrotte im Greuter Wald, Richtung Badesee und Dorf führen nun Wege, die für Rollatoren geeignet sind und genügend Gelegenheit zum Ausruhen und Pausieren bieten: quasi „Boxenstopps“ für Spaziergänger. Darüber freut sich auch Andrea Käshammer. Die 55-Jährige hat eine behindertengerechte Wohnung im Haus St. Gebhard. Durch ihre MS-Erkrankung ist sie bei weiteren Strecken, die sie zu Fuß gehen möchte, auf ihren Rollator angewiesen. Sie hat sich Bänke von der Gemeinde gewünscht: „Ich habe Herrn Bürgermeister Moll einen Brief geschrieben und gesagt, dass im Ort Ruhebänke fehlen“, erzählt Andrea Käshammer.

Impressum
Fotos, Videos und Texte
Corinna Konzett, Marlene Gempp, Jan Peter Steppat, Bernd Treffler, Simon Nill, Herbert Beck, Steffen Lang, Tobias Schumacher, Gisela Sgier, Liane Sprenger, Claudia Bischofberger, Alexis Albrecht
Verantwortlich
Yannick Dillinger, Jasmin Off
Kontakt
www.schwäbische.de
Karlstraße 16
88212 Ravensburg
Telefon: 0751 / 2955 5555
online@schwaebische.de
Copyright
Schwäbische Zeitung 2017 - alle Rechte vorbehalten













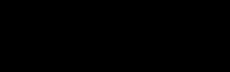












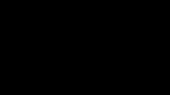











 Hier will ich alt werden
Hier will ich alt werden
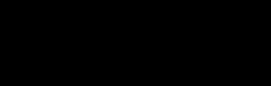
 Pflege daheim
Pflege daheim
 Plötzlich 80
Plötzlich 80


 Sport für Jung und Alt
Sport für Jung und Alt
 Vorleser, Seelentröster, Handtaschenfinder
Vorleser, Seelentröster, Handtaschenfinder
 Autonomes Fahren im Alter
Autonomes Fahren im Alter
 Mit Kursen gegen die Einsamkeit
Mit Kursen gegen die Einsamkeit
 Senioren lernen Skypen
Senioren lernen Skypen
 Neue Tagespflege Carl-Joseph kommt bisher gut an
Neue Tagespflege Carl-Joseph kommt bisher gut an
 Ein Rollatorenparcours für Amtzell
Ein Rollatorenparcours für Amtzell