Weingarten

Vollbild
„Das ist das größte kommunale
Investitionsprojekt in der Geschichte der Stadt Weingarten“, sagte
Oberbürgermeister Markus Ewald und meinte damit die Neuausrichtung des
Schulstandortes Weingarten. Denn nicht 20 Million Euro, sondern fast 38
Millionen Euro wird die Stadt in den kommenden zehn Jahren dafür investieren
müssen. Die Gesamtsumme beträgt gar knapp 49,4 Millionen Euro, soll aber durch
Förderungen vom Land Baden-Württemberg aufgefangen werden. Für das Geld gibt es
dann aber auch einen relativ modernen Schulstandort, der Weingarten durch die
kommenden 50 Jahre helfen soll.
Denn aktuell sind zu viele Gebäude an der
Talschule sowie dem Schulzentrum veraltet. Einige von ihnen sind so marode,
dass sie abgerissen werden müssen. Gerade an der Talschule ist die Bausubstanz
besonders schlecht. Daher werden hier, wie auch am Schulzentrum (für die Werkrealschule),
Neubauten entstehen. Zudem sollen Gymnasium und Realschule saniert und
erweitert werden. Denn neben dem Alter der Gebäude schlagen auch andere
Faktoren bei der Neuausrichtung zu Buche. So ist der Raumbedarf schon jetzt
höher als der Bestand. Durch neue pädagogische Konzepte und steigende
Geburtenzahlen wird dieser Flächenbedarf in den kommenden Jahren weiter
ansteigen. Außerdem wurde in diesem Sommer der Schulstandort Promenade nach 108
Jahren aufgeben. Das altehrwürdige Gebäude wird aktuell zu einem Kindergarten
umgebaut.
Doch damit nicht genug. Auch in einem anderen
Bereich von Bildungs-Fachbereichsleiter Rainer Beck steht Weingarten vor großen
Herausforderungen. Durch steigende Geburtenzahlen und immer mehr Eltern, die
schon früher einen Kitaplatz für ihr Kind in Anspruch nehmen, fehlen bis zum
Jahr 2021 65 Kindergartenplätze. Um diese dann auch garantieren zu können,
haben Stadtverwaltung und Gemeinderat in diesem Jahr an einigen Schrauben
gedreht. So wurde im Mai im Rahmen der Kindergartenkonzeption entschieden, den
Xaverius-Kindergarten abzureißen und komplett neu zu bauen.
Doch
nicht nur das. Neben diversen Sanierungsmaßnahmen von anderen Kindergärten in
Weingarten, die noch ausstehen, wurde im Sommer mit dem Umbau der
Promenadeschule begonnen, der im Herbst 2019 abgeschlossen werden soll. Das
wiederum soll für die drei Gruppen des Xaverius-Kindergartens während des
Neubaus eine Ausweichmöglichkeit bieten. Sobald der Neubau in der
Irmentrudstraße fertiggestellt ist, können die Gruppen wieder zurückziehen. In
der Promenade soll ab 2021 das Kinderhaus Bullerbü – aktuell noch in der
Ravensburger Straße – eine neue Heimat finden. All das kostet die Stadt
Weingarten viele weitere Millionen Euro.
Zum Anfang
Weingarten 2
Zum Anfang
Vollbild
Doch offenbarten diese massive, grundlegende
Probleme der Alarmkette. So dauerte es jeweils zwischen 30 und 45 Minuten, bis
nach dem internen Alarm auch die Polizei verständigt wurde. Denn das waren
bislang zwei voneinander getrennte Schritte. Das hätte im Ernstfall wohl
katastrophale Folgen. Daher haben die Verantwortlichen des KBZO reagiert und
ein ganz neues Alarmsystem einbauen lassen, das es ermöglicht, die Polizei in
weniger als 60 Sekunden zu verständigen.
Bislang war eine direkte Aufschaltung eines
Alarms zur Polizei schon rein rechtlich nicht möglich. Dies hat der Landtag im
März geändert. Seitdem ist es laut Innenministerium möglich, die Schulen direkt
mit der Polizei zu verbinden – aber nur über technische Mittel wie Transponder
oder Notfall-Knöpfe. Das KBZO hat derweil sich für ein Nischensystem
entschieden, weil die Sorge vor Missbrauch und damit weiteren Fehlalarmen zu
groß ist.
Zwar ist der Alarm des neuen Systems rein
formell nicht direkt auf die Polizei aufgeschaltet wie beispielsweise bei
Feueralarm-Knöpfen, durch welche direkt auch ein Alarm bei der Feuerwehrleitstelle
eingeht. Und doch wird die Alarm auslösende Person, wenn gewünscht, direkt mit
der Polizei verbunden.
Und so funktioniert’s: Pädagogen und
Therapeuten an der Geschwister-Scholl-Schule werden künftig eine Telefonnummer
haben, die sie im Alarmfall wählen müssen. Eine Computerstimme fragt dann nach,
ob man wirklich Alarm auslösen will. Bestätigt der Anrufer, wird der Alarm über
Lautsprecher in den Schulgebäuden ausgelöst.
Zudem wird der Anruf direkt an das
Polizeipräsidium in Konstanz durchgestellt – es ist ein normaler 110-Notruf.
Dort bewerten die Beamten die Situation und leiten weitere Maßnahmen, wie
beispielsweise die Alarmierung des Spezialeinsatzkommandos (SEK), ein. So soll
mit einem einzigen Anruf sichergestellt werden, dass die Polizei auf jeden Fall
informiert wird.
Vorfälle offenbaren grundlegende Probleme
bei der Alarmierung der Polizei – Verantwortliche reagieren
Zum Anfang
Weingarten 3

Vollbild
So wenige Reiter gab es seit 35 Jahren beim
Blutritt nicht mehr. Die Zahlen veranlassten Dekan und Blutreiter Ekkehard
Schmid bei der Versammlung der Blutreiter-Gruppenführer am Ostermontag zu
deutlichen Worten. Der Ritt müsse wieder mehr zur Prozession werden, mahnte der
Dekan. Das gelte vor allem für die Strecke auf der Flur: „Da ist Ruhe, da wird
nicht gequatscht.“ Der Ritt über die Flur sei ein Gottesdienst, also solle
entweder Stille herrschen oder gebetet werden.
Schmid wiederholte diese Ermahnung in zwei
Interviews mit der „Schwäbischen Zeitung“ Mitte April und kurz vor dem
Blutritt. Schmid sprach über den Volksfestcharakter der weltweit größten
Reiterprozession und betonte noch einmal die Aufgabe der Reiter, den religiösen
Kern nicht aus den Augen zu verlieren. Als Reiter habe man eine Vorbildfunktion
und sei in einer besonderen Verantwortung.
Zum Anfang

Vollbild
Angesichts des Reiterrückgangs
stellte sich automatisch auch die Frage, ob sich der Blutritt künftig nicht
auch für Frauen öffnen müsse. Frauen sind beim Blutritt als Reiter traditionell
ausgeschlossen. Er ist eine reine Männerprozession.
Frauen beim Blutritt? Das ist eine Frage, die
kaum jemand zu stellen wagte, weil sie zu heftigen Diskussionen führte. Für die
einen ist der Ausschluss eine Diskriminierung, ihnen gilt der Blutritt als
archaisch. Die andere Seite betont die Tradition, die es zu bewahren gilt.
Schmid zeigte sich im Interview überraschend offen. Frauen beim Blutritt? „,Das
ist nicht auszuschließen“, sagte er. Es komme schließlich nicht auf die
Geschlechtszugehörigkeit an, sondern auf die innere Haltung.
Ob
diese Öffnung allerdings das Nachwuchsproblem löst, ist unwahrscheinlich.
Dieser Meinung ist Christoph Sprißler, 1. Vorsitzender der
Blutfreitagsgemeinschaft. Auch er verschließt sich nicht dieser Vorstellung,
doch gebe es intern diese explizite Forderung nicht. Für ihn ist die Pferde-Beschaffung
mitverantwortlich für den Rückgang der Reiter. Entscheidend sei aber - und hier
folgt er der Argumentation des Dekans -, dass die Blutreiter die Prozession
leben und sich auf den Kern der Prozession als Gottesdienst besinnen. Dieses
Problem werde auch eine Öffnung für Frauen nicht lösen.
Zum Anfang
Weingarten 4

Vollbild
Die Entstehung des neuen Stadtviertels auf dem
ehemaligen Schuler-Areal ist ein Jahrhundert-Projekt und ein Meilenstein in der
Geschichte der Stadt Weingarten. „Es wird das Stadtbild in den nächsten 50 bis
100 Jahre prägen“, sagte Oberbürgermeister Markus Ewald. Auf dem 36000
Quadratmeter großen Areal sollen bis 2025 rund 500 neue Wohnungen und Gewerbe
entstehen. Das entspricht einer Größe von sechseinhalb Fußballfeldern.
Wie das neue Stadtviertel aussehen kann, wurde
der Öffentlichkeit erstmals Ende Oktober gezeigt.
Zum Anfang

Diskussion um das neue Schuler-Areal: Nikolas Werckshagen (Stadt Weingarten), Oliver Braun (Ackermann + Raff), Alexander Stuchly (I+R Wohnbau), Werner Binotto (Juryvorsitzender) und Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald
Zum Anfang

Vollbild
Das Modell ist jedoch nicht unumstritten. „Ein
bisschen besser als befürchtet“, kommentierte Karl-Anton Feucht, Vorsitzender
des Weingartener Gewerbe- und Handelsvereins (GHV), den Siegerentwurf.
Den Erwartungen des GHV wird der Entwurf von
„Ackermann + Raff“ allerdings nicht gerecht. Verantwortlich dafür sei aber
nicht der Investor, sondern vielmehr die Stadtverwaltung. „Die Ausgewogenheit
fehlt“, meint Feucht. „Wir hatten gehofft, dass der Anteil an Gewerbe größer
wird.“ Es gebe wenige Flächen, die für Gewerbe und Einzelhandel zugelassen
sind. Und das Gewerbe darf nur sehr leise sein und nicht stören. Eine wirkliche
Entwicklung zu einem lebendigen Stadtteil ist damit nicht oder nur sehr
eingeschränkt möglich.“ Es habe an Mut gefehlt, etwas Modernes und Lebendiges
zu schaffen. Die Innenstadt werde auch in Zukunft große Probleme haben.
Schon
im kommenden Herbst soll mit den Abrissarbeiten begonnen werden. 2020 werden
die ersten Häuser gebaut, und zwei Jahre später sollen schon die ersten Mieter
in ihre neuen Wohnungen einziehen.
Zum Anfang
Gemeinden
Zum Anfang

Vollbild
Emotionalstes
Thema ist die Trinkwasserversorgung. Die beiden Gemeinden Baienfurt und Baindt
beziehen ihr Trinkwasser über die Zweckverband-Wasserversorgung Baienfurt-Baindt
aus der Quelle Weißenbronnen im Altdorfer Wald. Diese befindet sich in der Nähe
des geplanten Abbaugebietes. Da gab es direkt im Januar einen politischen
Paukenschlag aus Baienfurt, wo der Gemeinderat in einer Sitzung beschlossen
hat, ein eigenes geologisches Gutachten in Auftrag zu geben. Der beauftragte
Geologe Hermann Schad aus Wangen soll nun klären, inwieweit ein Kiesabbau in
Grund Auswirkungen auf die Quelle Weißenbronnen hat. Die Ergebnisse werden 2019
erwartet. Kurz darauf
hat im Februar auch Kiesunternehmer Rolf Mohr von der Kiesgesellschaft Karsee
(„Meichle und Mohr“) seinen Antrag auf Zielabweichung ruhend gelegt.
Gleichzeitig gab Mohr eigene Bohrungen auf dem Gebiet der geplanten Kiesgrube
in Auftrag, die dann im Spätsommer bereits abgeschlossen waren. Das vor einem
Jahr gestartete sogenannte Zielabweichungsverfahren sollte dazu dienen, den
Prozess, Kies in Grund abzubauen, voranzutreiben.
Zurzeit
beschäftigt sich die Politik auch mit dem Thema Kiesexport.
Zum Anfang

Vollbild
Nach Recherchen der
„Schwäbischen Zeitung“ („Kieshunger“, SZ vom 15. September) gehen mehr als eine
Million Tonnen Kies pro Jahr aus der Region Bodensee-Oberschwaben nach
Vorarlberg und in die Schweiz, weil dort erstens die Auflagen für den Abbau
höher sind und zweitens der Preis für den Baurohstoff höher ist. So lohnt sich
der Import von Kies aus Deutschland. Zum Vergleich: Die Landkreise Bodensee,
Sigmaringen und Ravensburg gehen von einem jährlichen Bedarf von neun Millionen
Tonnen aus. Allein mit der Bodenseefähre Friedrichshafen-Romanshorn sind 100000
Tonnen in die Schweiz transportiert worden.
Gespräche mit Regierung
Erst im
November war nun der Direktor des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben,
Wilfried Franke, in Österreich, um Gespräche mit der Vorarlberger
Landesregierung zu führen. Denn laut einer Vorarlberger Studie wird in
Vorarlberg nicht mehr viel Kies abgebaut. Momentan werden 2,75 Millionen Tonnen
an Steinen und Kies pro Jahr aus der Erde geholt, Tendenz jedoch stark fallend.
Den fehlenden Rest müsste das österreichische Bundesland dann über Importe aus
Deutschland und Tirol ausgleichen. „Wir wollten auch deutlich sagen, dass das
Land Vorarlberg eigene Anstrengungen unternehmen muss, um die Eigenversorgung
hoch zu halten“, sagte Franke in einem Gespräch mit der SZ.
Auch 2019
wird Kiesabbau ein großes Thema bleiben. Spätestens, wenn die Ergebnisse des
geologischen Gutachtens vorgestellt werden.
Sämtliche Texte und Videos rund um das Thema Kiesabbau hat die
„Schwäbische Zeitung“ in einem Online-Dossier unter
www.schwäbische.de/kiesabbau
zusammengestellt.
Zum Anfang
Zum Anfang
Gemeinden 2
Zum Anfang

Vollbild
Angeklagt
war ein bei der Tat 34 Jahre alter Mann. Ihm wurde vorgeworfen, seine Frau
ermordet und dann einen Unfall vorgetäuscht zu haben. An einem Sonntagmorgen
Ende Februar 2017 machte ein Spaziergänger auf einem Feld am
Gemeindeverbindungsweg zwischen Hoßkirch und Ostrach-Tafertsweiler einen
grausigen Fund: Die Frau saß tot auf dem Fahrersitz eines Mercedes Vito, der
Motor läuft, die Heizung ist voll aufgedreht. Rund hundert Meter entfernt lag
ein Mann, ihr Ehemann, im Feld – schwer verletzt und bewusstlos. Es war ein
mysteriöser Fall, bei dem es lange um die Frage „Verkehrsunfall oder
Gewaltverbrechen?“ ging.
In den folgenden Tagen
stellte sich durch die Obduktion des Leichnams heraus, dass die Ehefrau nicht
an einem Unfall starb, sondern erwürgt worden ist. Die kriminaltechnischen
Untersuchungen deuteten darauf hin, dass der Mann als Täter infrage kam.
Schnell war klar, dass sich hier ein Familiendrama abgespielt haben muss.
Für
die Region war es ein Schock, war doch erst ein paar Wochen zuvor das Urteil im
Berger Mordprozess gesprochen worden, bei dem sich herausstellte, dass der
Ehemann seine Frau getötet und einen Suizid inszeniert hat.
Der Angeklagte schweigt
Zum Anfang

Vollbild
Der startete dann im November 2017 und zog sich bis ins Frühjahr 2018, da es
sich um einen Indizienprozess handelte und sich der Angeklagte ausschwieg.
Verhandlungstag für Verhandlungstag kamen immer mehr Details zu dem Vorfall und
dem Privatleben des Paares ans Tageslicht. Einem Rechtsmediziner zufolge wurde
die 30-Jährige zweifelsfrei erstickt, wies keinerlei Verletzungen auf, die auf
einen Verkehrsunfall hindeuten würden. Relativ frische Blutspuren im
Eingangsbereich des Wohnhauses in Hoßkirch wurden gefunden. In einer Garderobenschublade
sowie einer Tasche des Angeklagten fanden Ermittler blutverschmierte
Frischhaltefolie, außerdem 17 ausgerissene Haare der Getöteten an
Fleecehandschuhen. Textilfaserspuren deuten darauf hin, dass der Angeklagte die
Frau getragen und auf die Rückbank des Mercedes Vito gelegt hat.
Der Verdacht auf Befangenheit
der Schöffin im Prozess wurde im Verhalten der Schöffin deutlich, weil sie in
einem Gespräch mit der Nebenklägerin – der Mutter der Getöteten – sehr vertraut
gewirkt habe. Allein der Eindruck, dass Befangenheit besteht, reicht aus, einen
Prozess zu kippen, erklärte damals Franz Bernhard, der Pressesprecher des
Landgerichts Ravensburg. In dem Gespräch von Schöffin und Nebenklägerin soll es
auch um die Familie sowie die Kinder gegangen sein.
Nach zehn weiteren
Verhandlungstagen fiel dann im Juli das Urteil: Das Gericht sah es als erwiesen
an, dass der Angeklagte seine Frau getötet hat, und verteilte ihn zu
lebenslanger Haft.
Im September gab es noch
einmal Aufregung im Fall Hoßkirch. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat gegen
den Bürgermeister von Hoßkirch, Roland Haug, Anklage wegen falscher uneidlicher
Aussage erhoben. Er war im Februar als Zeuge vor dem Landgericht geladen und
widersprach Aussagen von zwei Kriminalbeamten. Der Termin für die öffentliche
Verhandlung vor dem Amtsgericht steht noch nicht fest.
Alle Texte zum
Hoßkirch-Prozess und die Entwicklung finden Sie in einem Online-Dossier unter
www.schwäbische.de/mord-hosskirch
Zum Anfang
Zum Anfang
Sport 2

Vollbild
Was für eine Saison für die Ravensburg
Razorbacks. In der German Football League 2 Süd, der zweithöchsten deutschen
Spielklasse für American Footballer, wollten die Ravensburger den Abstand zur
Spitze etwas verringern. Herausgekommen ist eine souveräne Meisterschaft und
der Einzug in die Aufstiegs-Play-offs.
Dort war dann aber nichts mehr drin gegen den Erstligisten
Stuttgart Scorpions. Ersatzgeschwächt hatten die Razorbacks sowohl im
Gazi-Stadion in Stuttgart als auch beim Rückspiel im Weingartener
Lindenhofstadion keine Chance. Die Saison ist dennoch ein voller Erfolg für die
Footballer des TSB Ravensburg gewesen. Mehr als 1500 Zuschauer kamen im Schnitt
zu den acht Heimspielen nach Weingarten. Herausragend war das Spiel gegen die
Gießen Golden Dragons. Zu dieser Partie am Samstagabend unter Flutlicht kamen
Anfang August über 2400 Besucher.
Zum Anfang
Zum Anfang
Zum Anfang
Sport
Zum Anfang

Vollbild
Der Tiefpunkt des Jahres war
Anfang März erreicht: Die Stimmung im damaligen Stadionrestaurant „1881“ in der
Eissporthalle bei der Abschlussfeier der Saison 2017/18 als schlecht zu
bezeichnen, wäre unzureichend. Miserabel trifft es schon besser. Katastrophal
ist der Realität vermutlich noch ein Stück näher. Vereinsführung, Spieler und
Fans wussten allesamt so gar nicht, wer sich mehr darüber aufregen sollte, dass
die Towerstars durch ein dramatisches 2:3 nach Verlängerung bei den Eispiraten
Crimmitschau wenige Tage zuvor in den Pre-Play-offs ausgeschieden waren. Das
„1811“ glich deshalb einem Pulverfass, das an der einen oder anderen Stelle
sogar explodierte.
Publikumsliebling Slavetinsky muss gehen
Zum schlechten Schluss gaben
die Towerstars auch noch die Trennung vom bei den Fans sehr beliebten
Verteidiger Lukas Slavetinsky bekannt. Das Aus in Crimmitschau war
für die Towerstars der Schlusspunkt hinter eine Spielzeit, die vor allem
geprägt war von etlichen Personalproblemen. Die Liste der verletzten, teilweise
lange verletzten Spieler war in aller Regel lang. Die Ergebnisse waren deshalb
selten so, dass es Hoffnung gegeben hätte, der Weg der Ravensburger würde weit
in die Play-offs hinein führen. So stand am Ende vor allem die Erkenntnis, dass
sich diese Saison keinesfalls wiederholen dürfe.
Zum Anfang

Vollbild
Den Sommer verbrachte die
Towerstars-Geschäftsführung damit, sich nach starkem Personal umzusehen, das
die Wahrscheinlichkeit auf eine erneut schwache Saison möglichst minimiert. Die
Mühen wurden belohnt. Alle Neuzugänge erfüllte die Erwartungen, der Kader
präsentierte sich geschlossen, tatkräftig – und weitestgehend verletzungsfrei.
Es machte plötzlich wieder Spaß, zu den Towerstars in die Eissporthalle zu
gehen. Schließlich war Ravensburg bald Tabellenführer und gab diese Position
nicht mehr her.
Es gelangen große Siege gegen
die direkten Konkurrenten, beeindruckende Aufholjagden, bemerkenswerte
Defensivleistungen in langer Unterzahl, mehrfach war die Eissporthalle sogar
ausverkauft. Zu den sportlichen Erfolgen kamen im Herbst 2018 auch die Signale aus
dem Gesellschafterbeirat, dass das Ziel in Angriff genommen werden soll, in die
DEL aufzusteigen – wenn auch nicht gleich in der erstmöglichen Saison 2021/22.
Aber dann.
Dazu brauche es eine neue
Halle, ließen die Verantwortlichen um den Beiratsvorsitzenden Frank Kottmann
und Geschäftsführer Rainer Schan wissen. Und mehr Geld brauche es natürlich
auch. Zuerst aber genießen alle miteinander den sportlichen Erfolg. Denn der
ist schließlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass der Aufstieg in die höchste
Liga einmal gelingen kann.
Zum Anfang
Scrollen, um weiterzulesen
Wischen, um weiterzulesen
Wischen, um Text einzublenden



































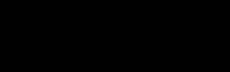






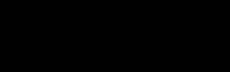



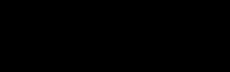

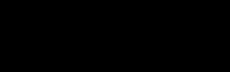

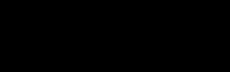


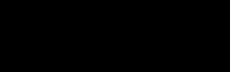

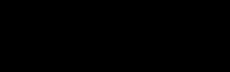



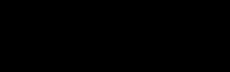
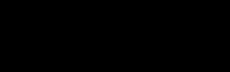


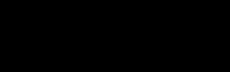



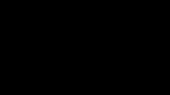






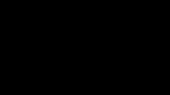



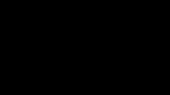

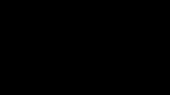

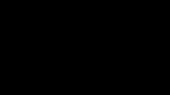


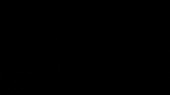

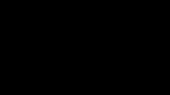



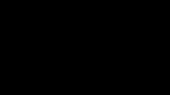
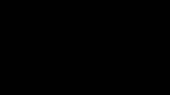


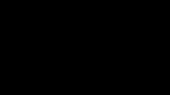

 Jahresrückblick: Das geschah in Ravensburg, Weingarten und den Gemeinden
Jahresrückblick: Das geschah in Ravensburg, Weingarten und den Gemeinden
 Die Messerattacke und ihre Folgen
Die Messerattacke und ihre Folgen
 Oberbürgermeister überredet Amokläufer zur Aufgabe
Oberbürgermeister überredet Amokläufer zur Aufgabe
 Mutmaßlicher Messerstecher war schon vor der Tat auffällig
Mutmaßlicher Messerstecher war schon vor der Tat auffällig
 Bis zu 2500 Menschen demonstrieren gegen Hass und Rassismus
Bis zu 2500 Menschen demonstrieren gegen Hass und Rassismus
 Für ihren Mut: Ravensburger Helfer nach Messerattacke geehrt
Für ihren Mut: Ravensburger Helfer nach Messerattacke geehrt
 St. Jodok brennt: Ravensburg in Angst
St. Jodok brennt: Ravensburg in Angst
 So tickt der Brandstifter von St. Jodok
So tickt der Brandstifter von St. Jodok
 Lange Haftstrafe für Brandstifter
Lange Haftstrafe für Brandstifter
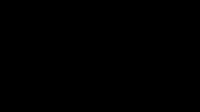 Der OB und seine Pläne: Was Daniel Rapp nach seiner Wiederwahl erwartete
Der OB und seine Pläne: Was Daniel Rapp nach seiner Wiederwahl erwartete
 Klage gegen das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl
Klage gegen das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl
 Keine Amtseinführung für OB Rapp
Keine Amtseinführung für OB Rapp
 Warum es doch keinen Luftreinhalteplan für Ravensburg gibt
Warum es doch keinen Luftreinhalteplan für Ravensburg gibt
 Stadt will jetzt Flüsterasphalt statt Tempo 30
Stadt will jetzt Flüsterasphalt statt Tempo 30
 Komplette Neuausrichtung des Bildungsstandortes
Komplette Neuausrichtung des Bildungsstandortes
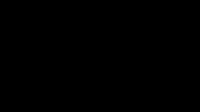 Große Aufregung durch Amokfehlarme am KBZO
Große Aufregung durch Amokfehlarme am KBZO
 Polizei erfährt erst nach 30 Minuten vom Amokalarm
Polizei erfährt erst nach 30 Minuten vom Amokalarm
 Dekan Ekkehard Schmid mahnt zur Rückbesinnung auf den Blutritt als Gottesdienst ...
Dekan Ekkehard Schmid mahnt zur Rückbesinnung auf den Blutritt als Gottesdienst ...
 ...Frauen beim Blutritt nicht auszuschließen
...Frauen beim Blutritt nicht auszuschließen
 Ein neues Stadtviertel entsteht
Ein neues Stadtviertel entsteht
 Klarheit und Vielfalt überzeugen
Klarheit und Vielfalt überzeugen
 Ein umstrittenes Modell
Ein umstrittenes Modell
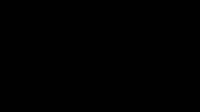 Kies wird Thema: Der Protest aus Oberschwaben schlägt hohe Wellen
Kies wird Thema: Der Protest aus Oberschwaben schlägt hohe Wellen
 Thema Wasser kocht hoch
Thema Wasser kocht hoch
 Kieshungrig: Nachfrage auch aus Voralberg und der Schweiz
Kieshungrig: Nachfrage auch aus Voralberg und der Schweiz
 Kiesabbau bleibt Thema
Kiesabbau bleibt Thema
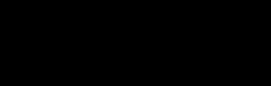 Zum Hintergrund:
Zum Hintergrund:
 Das Urteil
Das Urteil
 Furios zur Meisterschaft
Furios zur Meisterschaft
 Trainer kehrt nach Hause zurück
Trainer kehrt nach Hause zurück

 Schlimmes Frühjahr, schöner Herbst
Schlimmes Frühjahr, schöner Herbst