Kuhglocken: Eine Tradition in der Kritik
Seit einigen Jahren stehen sie in der Kritik.
Ist diese gerechtfertigt? Leiden die Tiere unter den Schellen? Und steht eine Tradition in den Alpen auf dem Prüfstand?
Musik auf 1100 Metern
Dort oben auf 1100 Höhenmetern ist es in den Sommermonaten nur selten still. Das liegt nicht nur an den Tausenden Touristen, die von der Bergstation der Hündle-Bahn zum Gipfel laufen und dabei die Sennalpe passieren.
Auf den Wiesen rund um den Hof grasen 40 Milchkühe, zehn Kälber und 40 Jungtiere. Die meisten von ihnen tragen Glocken oder Schellen, die bei jeder Kopfbewegung läuten.
Nicht überall sind diese Klänge gleichbedeutend mit Idylle.
Glockenklänge vor Gericht
Der erste Fall aus Holzkirchen ging durch mehrere Instanzen und zog sich über Jahre hin. Ein Ehepaar hatte eine Landwirtin verklagt, weil sie ihre Kühe mit Glocken auf einer Wiese im Ort grasen ließ. Der Rechtsstreit endete erst vor dem Oberlandesgericht - mit einem Vergleich.
Im Sommer 2020 endete ein weiterer Rechtsstreit vorerst ergebnislos: In Bad Tölz-Wolfratshausen möchte ein Ehepaar Ruhe auf der Weide neben dem Schlafzimmerfenster.
Klangvoller Beruf: Älpler am Hündle
Der 55-Jährige verbringt den ganzen Sommer auf der Alpe und kümmert sich um sein Vieh. Die Milchkühe kommen jeden Abend zum Melken in den Stall auf der Alpe. Aus der Milch stellt Haser Käse her.
Der Klang der Glocken und Schellen ist für den Senner untrennbar mit der Alpe verbunden: "Eine Kuh ohne Schelle oder Glocke ist eine nackte Kuh."
Akustische Standortbestimmung
Jede Kuh, jedes Kalb, jedes Jungtier muss er jeden Tag einmal gesehen haben, um zu wissen, dass es allen gut geht.
Die Glocken verraten ihm bei Nacht und Nebel und in unübersichtlichem Gelände, wo sich seine Tiere aufhalten.
Er ist mit seinen Tieren so vertraut, dass er sie am Klang der Schelle erkennt.
Alternative GPS-Sender?
Erstens sind die Sender nicht zuverlässig, sagt der Senner: "Wenn der Akku leer ist, ist das Rind nicht mehr zu finden." Er müsste täglich zig Geräte aufladen und kalibrieren - denn ein paar Höhenmeter können in den Bergen viel ausmachen.
Zweitens müssten die GPS-Sender oben am Halsband sitzen. "Damit sie nicht unter den Hals des Tieres rutschen, müsste man ein Gegengewicht befestigen, das nach unten zieht", sagt Haser - doch eben das Gewicht kritisieren einige Tierschützer.
Drittens können die Tiere bei schlechter Sicht im freien Gelände den Anschluss an ihre Herde verlieren.
Tierschutz als Argument
Im Jahr 2015 löste die gebürtige Holländerin Nancy Holten in der Schweiz eine Debatte aus und begann, für ein Verbot der Kuhglocken in der Schweiz zu kämpfen. Auf ihrer Facebook-Seite sammelt sie Videos und Fotos.
Bisher gibt es nur eine einzige wissenschaftliche Arbeit, die sich mit der Auswirkung von Kuhglocken auf das Tierwohl befasst: Eine Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich belegte angeblich, dass Tiere mit Glocken weniger ruhen, weniger fressen und weniger wiederkäuen.
Doch die Studie stieß bei genauerer Betrachtung schnell auf Kritik. So waren die verwendeten Glocken deutlich schwerer als die im Alltag genutzten Schellen. Die Hochschule räumte nach Medienberichten ein, dass die Ergebnisse dramatischer dargestellt worden seien als sie waren.
Freude statt Belastung
"Jedes Rind kennt den Klang der eigenen Schelle", sagt er. Sie dient auch als Signal: Am Klang erkennen die Rinder ranghöhere Tiere, denen sie ausweichen.
Apropos ausweichen: Haser beobachtet seit Jahr und Tag, dass Rinder nicht mehr Abstand von ihren Artgenossen mit Schelle halten als von jenen ohne Glocke.
Stören die Schellen die Kühe?
Glocken und Schellen
Der Unterschied: Glocken (links im Bild) sind gegossen, die Schellen geschmiedet.
Die Älpler im Allgäu sprechen aber nicht nur von Glocken und Schellen. Die flachen Schellen nennt Haser "Kleapfe". Die großen Zugschellen, die er seinen Tieren nur zum Viehscheid für wenige Stunden anlegt, heißen im Dialekt "Bumpl".
Die verschiedenen Metalle und Formen sorgen dafür, dass das Geläute melodisch klingt. Hansjörg Haser achtet immer darauf, dass alle Schellen und Glocken in gutem Zustand sind. Eine alte Schelle kann scheppern und das ganze Geläute zerstören.
Das Gewicht der Schellen
Handwerk mit Geschichte
Die meisten Glocken wurden aus der Glockengießerei in Kempten angefertigt. Heute gibt es diese Gießerei nicht mehr.
Die Tradition, dass Herdentiere Schellen tragen, stammt schon aus der Zeit der Römer, als die Hirten ihren Tieren hohle Nüsse und Schalen anhängten, um sie leicht wiederzufinden.
Archäologische Funde aus dem 12. und 13. Jahrhundert zeigen, dass Hirten beim Hüten Schellen und Glöckchen nutzten, um ihre Herden beieinander zu halten.
Touristen auf Tuchfühlung
Doch der Zaun hält viele Besucher nicht ab, die Tiere zu streicheln, sie anzufassen oder mit ihnen für Fotos zu posieren.
Hansjörg Haser hat dafür zwar Verständnis, bittet aber auch um Rücksicht und Vorsicht.
Klicken Sie auf den Play-Button, um das Video zu sehen.
Sonderfall Viehscheid
Die großen Glocken und Schellen, die bis zu sieben Kilogramm wiegen, tragen die Kühe ausschließlich zum Viehscheid - auch Almabtrieb genannt.
Das Kranzrind führt mit Kopfschmuck und Bumpl geschmückt die Herde auf dem Weg ins Tal an.
"Wie ein Tiroler ohne Hut"
Wie die zahlreichen Gäste, die im Sommer auf den Ausflugsberg strömen, auf das Geläute reagieren und wie er selbst die Geräuschkulisse nahe des Gipfels wahrnimmt, berichtet er im Video.
Klicken Sie auf den Play-Button, um das Video anzuschauen.
Gedicht für die Gegner
Im Streitfall von Wolfratshausen hat Jost Hartmann-Hilter, der Anwalt des Landwirts, dem die weidenden Tiere gehören, in Versform auf die Klage reagiert:
„Zig Menschen wohnen seit Jahrzehnten um die Weide.
Noch niemandem taten grasende Kälbchen etwas zuleide.
Kuhglocken, die gab's in Greiling immer schon.
Und haben deswegen eine lange Tradition.
Und wenn man aus der Stadt aufs Land rauszieht,
dann weiß man, dass es Kuh und Kalb und Glocken gibt.“
Die Gemeinde Bauma im Schweizer Kanton Zürich hat solche Rechtsstreitereien von vorneherein ausgeschlossen: Dort darf Lärm von Tier- und Kirchenglocken nicht mehr als Anlass für Klagen gelten. Die Tradition geht vor.
Impressum
Andrea Pauly
Videos und Schnitt:
David Weinert
Fotos:
Andrea Pauly
David Weinert (2)
Tourismus Bad Hindelang (1)
Verantwortlich:
Steffi Dobmeier, stv. Chefredakteurin und Leiterin digitale Inhalte
Schwäbische Zeitung
Karlstraße 16
88212 Ravensburg
www.schwaebische.de

















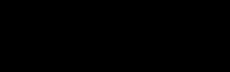
















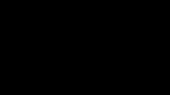
 Kuhglocken: Eine Tradition in der Kritik
Kuhglocken: Eine Tradition in der Kritik
 Musik auf 1100 Metern
Musik auf 1100 Metern
 Glockenklänge vor Gericht
Glockenklänge vor Gericht
 Klangvoller Beruf: Älpler am Hündle
Klangvoller Beruf: Älpler am Hündle
 Akustische Standortbestimmung
Akustische Standortbestimmung
 Alternative GPS-Sender?
Alternative GPS-Sender?
 Tierschutz als Argument
Tierschutz als Argument
 Freude statt Belastung
Freude statt Belastung
 Stören die Schellen die Kühe?
Stören die Schellen die Kühe?
 Glocken und Schellen
Glocken und Schellen
 Das Gewicht der Schellen
Das Gewicht der Schellen
 Handwerk mit Geschichte
Handwerk mit Geschichte
 Touristen auf Tuchfühlung
Touristen auf Tuchfühlung
 Sonderfall Viehscheid
Sonderfall Viehscheid
 "Wie ein Tiroler ohne Hut"
"Wie ein Tiroler ohne Hut"
 Gedicht für die Gegner
Gedicht für die Gegner
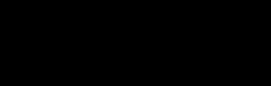 Impressum
Impressum