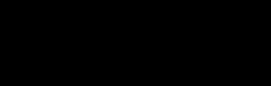Kapitel 1
Häfler erinnern sichMein Auto
Wir liebten es, wir schraubten
dran rum, wir knutschten darin, es begleitete uns durch die Studien- oder
Ausbildungszeit. Es gibt wohl nur wenige, bei denen der Gedanke an „mein Auto“
keine Erinnerungen weckt – an die Jugend, an wilde Zeiten, an das Gefühl
grenzenloser Freiheit.
Gemeinsam mit den User der Facebook-Gruppe "FRIEDRICHSHAFEN - damals, gestern, heute" und Lesern der Schwäbischen Zeitung haben wir uns auf die Suche nach schönen Geschichten und besonderen Erlebnissen gemacht.
Gemeinsam mit den User der Facebook-Gruppe "FRIEDRICHSHAFEN - damals, gestern, heute" und Lesern der Schwäbischen Zeitung haben wir uns auf die Suche nach schönen Geschichten und besonderen Erlebnissen gemacht.
Kurt JetterEin Roadster für die ganze Familie
Bis 1963 war Kurt Jetter ausschließlich mit dem Motorrad unterwegs. Der Hauptgrund dafür: „Beim Autofahren wurde mir schlecht“, verrät der heute 88-Jährige. Frau und Kind chauffiert er damals mit einem Triumph-Gespann durch Friedrichshafen. Irgendwann jedoch passten Mutter und die vierjährige Tochter nicht mehr in den Seitenwagen – ein Auto musste her. Oft ist Kurt Jetter schon beim Autohaus Zeller in der Friedrichstraße verharrt, wo er sein Traumauto im Schaufenster bewundert: den Victoria Spatz. Der kleine Roadster hat einen Einzylinder-Zweitaktmotor mit 10,2 PS unter der Haube und fährt 95 km/h Spitze. Die Sitzbank, hinter der Motor und Getriebe angebracht sind, bietet drei Personen Platz. Türen gibt’s keine, nur tiefere Einstiege. Als Wetterschutz dient ein Faltverdeck aus Stoff. Was Kurt Jetter am besten an diesem Auto gefällt: Er darf es mit seinem Motorradführerschein fahren. Im Sommer 1963 bietet sich eine sehr gute Gelegenheit, als ein gebrauchter Spatz in Kehlen-Reute zum Verkauf steht. Vor der Probefahrt weiß der 1,88-Hüne zunächst gar nicht, wie er in das kleine Cabrio hineinkommen soll. Einmal eingestiegen, sitzt er jedoch bequem und nimmt den Spatz für 350 Mark mit.
Als etwas gewöhnungsbedürftig erweist das elektromagnetisch geschaltete Getriebe. Drückt der Fahrer den Schaltknopf am Armaturenbrett, wird noch lange nicht der Gang gewechselt. Das passiert erst, wenn die Kupplung gedrückt wird – theoretisch also auch erst einen Kilometer später. Kuppeln ist nur möglich, wenn der Motor läuft.
Eines Tages im Winter 63/64 ist die Familie Jetter zwischen Tettnang und Tannau unterwegs. Dann passiert’s: Kurt Jetter tritt beim Auskuppeln ins Leere – das Seil ist gerissen. Was tun? Er hält an und würgt dabei den Motor im zweiten Gang ab. Kurt Jetter versucht das Kupplungsseil von Hand zu ziehen. Geht nicht. Er dreht den Zünschlüssel, während die ganze Familie versucht, duch Hin- und Herrutschen auf der Sitzbank dem Auto den entscheidenden Impuls zur Abfahrt zu geben. Und tatsächlich: Irgendwann tuckert der Spatz davon. Und irgendwie schafft es Kurt Jetter, seine Familie heil bis in die Ernst-Lehmann-Straße heimzubringen, und das im zweiten Gang, ohne anzuhalten.
Knapp anderthalb Jahre fahren die Jetters den kleinen Roadster, bis sie im Jahr 1964 Zwillinge bekommen – für 150 Mark macht der Spatz den Abflug.
Michael NöltgeDer Hingucker aus den USA
Ende der 50er-Jahre eroberte die „Knutschkugel“ die Herzen der Deutschen: die Isetta, das kleinste Auto, das BMW jemals gebaut hat. 1962 wird auch Michael Nöltge, der vorher mit einer Vespa unterwegs war, stolzer Besitzer einer Isetta – und zwar einer ganz besonderen.
800 Mark blättert der damals 22-Jährige für eine amerikanische Ausführung beim Autohaus Panzer in der Eugenstraße auf den Tisch. Die US-Isetta hat mit 300 Kubik und 13 PS einen etwas stärkeren Motor als das deutsche Pendant, mit größeren Scheinwerfern, Lüftungsschlitzen in der Tür und einem Rammschutz aus Chrom sieht sie auch um einiges cooler aus.
Michael Nöltge, damals als Soldat in der Häfler Löwentalkaserne stationiert, ist mit seinem kleinen Flitzer nicht auf der Straße unterwegs. Bei der Seegfrörne im Winter 62/63 nutzt er die Gelegenheit für eine Tour auf dem Bodensee. „Ich habe gesehen, dass die mit Rössern aufs Eis gehen und sogar Flugzeuge landen. Deshalb bin ich auch auf den See gefahren – einfach aus Gaudi“, sagt Michael Nöltge. Unser Bild entstand 1962 in der Kaserne am Flughafen, im Hintergrund ist der „Franzosenknast“ zu sehen. Sein Outfit, verrät er, entsprach übrigens absolut dem Zeitgeist: „Damals hat man natürlich einen Anzug angezogen.“
800 Mark blättert der damals 22-Jährige für eine amerikanische Ausführung beim Autohaus Panzer in der Eugenstraße auf den Tisch. Die US-Isetta hat mit 300 Kubik und 13 PS einen etwas stärkeren Motor als das deutsche Pendant, mit größeren Scheinwerfern, Lüftungsschlitzen in der Tür und einem Rammschutz aus Chrom sieht sie auch um einiges cooler aus.
Michael Nöltge, damals als Soldat in der Häfler Löwentalkaserne stationiert, ist mit seinem kleinen Flitzer nicht auf der Straße unterwegs. Bei der Seegfrörne im Winter 62/63 nutzt er die Gelegenheit für eine Tour auf dem Bodensee. „Ich habe gesehen, dass die mit Rössern aufs Eis gehen und sogar Flugzeuge landen. Deshalb bin ich auch auf den See gefahren – einfach aus Gaudi“, sagt Michael Nöltge. Unser Bild entstand 1962 in der Kaserne am Flughafen, im Hintergrund ist der „Franzosenknast“ zu sehen. Sein Outfit, verrät er, entsprach übrigens absolut dem Zeitgeist: „Damals hat man natürlich einen Anzug angezogen.“
Karl StähleDer verunglückte Hund
"Im Jahr 1955 wurde ich stolzer Besitzer eines Pkw Lloyd LP 400 mit luftgekühltem Zweitaktzylindermotor, Hubraum 400 cm³, 13 PS und staubsaugerähnlichem Sound", berichtet unser Leser Karl Stähle. Das amtliche Kennzeichen war FW 50 – 4286, wobei FW stand für "Französische Zone Württemberg". Bei einer Sonntagsausfahrt ins Friedrichshafener Hinterland passierte Karl Stähle ein Bauernhaus mit davorstehenden Bauersleuten. "Plötzlich sprang deren weißer Spitzer laut kläffend auf mein Auto zu und verbiss sich in die vordere Stoßstange. Nach einem Rumpler im hinteren Radkasten hielt ich an. Der Spitzer lag regungslos mit schwarz verschmiertem Fell auf der Straße", erzählt Karl Stähle. Den Hund hatte es durch den Radkasten gedreht, den er tags zuvor mit Altöl gegen Korrosion eingesprüht hatte. "Die Bauersfrau erklärte mir, dass der Hund ganz scharf auf Autos sei. Sie bat ihren Mann, doch gleich einen Spaten zu holen, um ihn zu begraben - sie könne es nicht mehr mit ansehen", erzählt Karl Stähle.Doch dann die Überraschung: "Als der Mann die Haustüre öffnete, sprang der Spitzer plötzlich auf und verschwand mit dem Mann im Haus. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört."
Georg FlotowEin Traum in weiß
Ende 1963 erfüllt sich Georg Flotow einen Traum. 1600 Mark („Das war damals viel Geld“) legt er beim Autohaus Bleicher für einen Käfer Cabrio auf den Tisch. Der Wagen, Baujahr 1956, 1184 Kubik, 30 PS, hat nur einen kleinen Schönheitsfehler: die Farbe grau-metallic. „Heutzutage würde ich mir niemals ein weißes Auto kaufen, aber damals musste ein Cabrio weiß sein“, erinnert sich der 81-jährige Ailinger.
In einer Scheune im Schwarzwald, die einem Bekannten gehört, verpasst er dem Käfer eine neue Lackierung. Ein paar Teile werden abmontiert, der Rest mit Papier abgeklebt – dann trägt Georg Flotow eigenhändig mit der Spritzpistole die Farbe auf. Richtig glatt ist der neue Lack zwar nicht, dafür liegt das Auto jetzt voll im Trend.
Die Freude an dem flotten Cabrio sollte allerdings nur etwas länger als zwei Jahre währen. Am 2. Januar 1966 will Georg Flotow von der Maybachstraße in die Keplerstraße einfahren. Es schneit, die Sicht durchs rechte Seitenfenster ist ziemlich eingeschränkt. Auf der Riedleparkstraße, die zu dieser Zeit vorfahrtsberechtigt ist, kommt ein anderer Käfer daher – und schon scheppert’s. Beide Autos sind komplett im Eimer und ein Fall für den Schrotthändler Luber aus Allmannsweiler. „Gott sei Dank ist keinem etwas passiert“, sagt Georg Flotow. „Damals gab’s ja keinen Gurt und erst recht keinen Airbag.“ Vom Unfall trägt er nur eine Beule davon, wenige Wochen später bekommt er jedoch vom Amtsgericht Tettnang noch einen mit: 40 Euro Strafe.
Elmar ReischEin W21 dank deutsch-französischer Freundschaft
Es gibt wohl keinen Spielfilm über Nazi-Deutschland, der ohne dieses Fahrzeug auskommt: der Wanderer W21 – der Dienstwagen von schneidigen Wehrmachtsoffizieren und finsteren Gestapomännern. Nach dem zweiten Weltkrieg brachten die französischen Besatzer immer mal wieder Wanderer, die sie beschlagnahmt hatten, unters Volk. Zu den Glücklichen, die einen ergattern können, gehört 1951 auch der Häfler Elmar Reisch. Weil er Französisch spricht, ist der 21-Jährige Lehrling beim Bosch-Dienst für die Kunden vom französischen Militär zuständig. Die Soldaten kommen regelmäßig vorbei, um Ersatzteile einzukaufen. Für den Preis von 100 Euro bekommt Elmar Reisch von Capitaine Lepoix einen Wanderer zugeschanzt. Nur ein Jahr später – der W21 ist schon wieder verkauft – legt er sich das Nachfolgemodell W24 zu. Bei einer Fahrt im strömenden Regen von München nach Friedrichshafen, erinnert sich der 86-Jährige, gibt dieses Auto mit einem Kolbenfresser den Geist auf.
Seiner Liebe zu Autos und seiner Verbundenheit mit den Franzosen tut dieser Zwischenfall keinen Abbruch. Gemeinsam mit französischen Soldaten restauriert er in den kommenden Jahren viele Autos – der Erlös wird aufgeteilt.
Siegfried Maier„Hero“ fährt Taunus
Der Schäferhund, der hier auf der Kawasaki Z 650 Platz genommen hat, hieß „Hero“ – und er war auch irgendwie ein Hero, also ein Held. Mit seinem feinen Näschen gehört er nämlich Mitte der 70er-Jahre zu den ersten Spürhunden in Deutschland, die harte Drogen erschnüffeln können. „Hero“, der in Diensten des Zolls steht, wird damals von Siegfried Maier trainiert. Der rote Ford Taunus Kombi bietet Herrchen und Hund viel Komfort, vor allem auf den langen Fahrten zu Lehrgängen ins fränkische Neuendettelsau, wo der Zoll noch heute seine Hundeschule hat. Siegfried Maier machte dieses Foto im Jahre 1978 auf dem Grundstück an der Möwenstraße, wo er und seine Frau 16 Jahre gelebt hatten.
Scrollen, um weiterzulesen
Wischen, um weiterzulesen
Wischen, um Text einzublenden















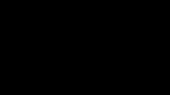
 Mein Auto
Mein Auto
 Ein Roadster für die ganze Familie
Ein Roadster für die ganze Familie
 Der Hingucker aus den USA
Der Hingucker aus den USA
 Der verunglückte Hund
Der verunglückte Hund
 Ein Traum in weiß
Ein Traum in weiß
 Ein W21 dank deutsch-französischer Freundschaft
Ein W21 dank deutsch-französischer Freundschaft
 „Hero“ fährt Taunus
„Hero“ fährt Taunus