Vorwort
Vorwort Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Vorwort Liebe Leserinnen, liebe Leser,



Ravensburg
RavensburgWie Corona das Leben in der Region verändert hatMeiste Todesopfer hatte der Kreis Ravensburg in der zweiten Pandemie-Welle zu beklagen
In den darauffolgenden Wochen trugen zahlreiche Skifahrer aus Österreich und Norditalien das Virus in den Kreis Ravensburg.
Ravensburg Ein Katastrophenjahr für das Rutenfest Absage, Finanzkrise und Führungsdebakel
Ravensburg Ein Katastrophenjahr für das Rutenfest Absage, Finanzkrise und Führungsdebakel


Es folgte die Finanzkrise der Rutenfestkommission, die laut Vorstand den Verein bis kurz vor die Zahlungsunfähigkeit führte. Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp gewährte auf die Schnelle eine Nothilfe in Höhe von 125.000 Euro, die Hälfte des Betrags, den die Stadt an die RFK jedes Jahr zahlt, damit die Ehrenamtlichen das Fest auf die Beine stellen können. Dieser Zuschuss sollte später im Jahr noch für Diskussionen sorgen. Gleichzeitig lief in der Stadt eine große Solidaritätsaktion an, um das geliebte Heimatfest zu retten. Der Zusammenhalt in Ravensburg wurde aber bald schon auf eine harte Probe gestellt.

RavensburgAufsehenerregende Fälle vor Gericht Brandstiftung am Goetheplatzhochaus und brutaler Angriff auf einen Polizisten
RavensburgFeuerwehr löscht Brand in Altstadt
RavensburgPolizeipräsidium ist zurück
RavensburgElektrifizierung: Großteil geschafftStrom für die Südbahn
Weingarten
Weingarten 14 Nothelfer endgültig geschlossen
Weingarten 14 Nothelfer endgültig geschlossen



Kirchengemeinderat St. Martin stimmt für die ÖffnungBlutritt öffnet sich für Frauen
Weingarten Martinshöfe nehmen Form an
Weingarten Martinshöfe nehmen Form an


Weingarten Grünes Licht für neue Talschule
Weingarten Grünes Licht für neue Talschule


Weingarten Kostenexplosion beim Gerätehaus
Weingarten Kostenexplosion beim Gerätehaus


WeingartenAbschied von Heinrich Grieshaber
Gemeinden
GemeindenEin Bus aus Ischgl brachte Corona mitKnappes Klopapier und kreative Ideen – Wie das Virus das Landleben umkrempelte
Gemeinden Alle reden vom Altdorfer Wald Debatte um Kiesabbau rückt das Waldgebiet in den Fokus – Das Thema erreicht die Politik
Gemeinden Alle reden vom Altdorfer Wald Debatte um Kiesabbau rückt das Waldgebiet in den Fokus – Das Thema erreicht die Politik



Gemeinden Grüne sind auf dem Land angekommen
Gemeinden Grüne sind auf dem Land angekommen



Gemeinden Eugen Abler tritt aus CDU aus
Gemeinden Eugen Abler tritt aus CDU aus



Gemeinden 70 Tiere sterben bei Brand in Baindt
Gemeinden 70 Tiere sterben bei Brand in Baindt



Gemeinden Streitpunkt Mobilfunk
Gemeinden Streitpunkt Mobilfunk



Gemeinden Baindter wird in Brasilien getötet
Gemeinden Baindter wird in Brasilien getötet



Gemeinden Urteil gegen Haug wird rechtskräftig
Gemeinden Urteil gegen Haug wird rechtskräftig



Sport
Sport Lange Pause, leere RängeNach Corona-Abbruch im März starten Ravensburg Towerstars erst wieder im November in neue DEL2-Saison
Sport Improvisation und Kurzarbeit statt Debüt American Footballer der Ravensburg Razorbacks müssen ein Jahr auf die Erstligapremiere warten
Sport Improvisation und Kurzarbeit statt Debüt American Footballer der Ravensburg Razorbacks müssen ein Jahr auf die Erstligapremiere warten


Erstmals in der Vereinsgeschichte hatten die Footballer des TSB Ravensburg Ende 2019 den Aufstieg in die German Football League (GFL) Süd geschafft. Sie freuten sich auf Derbys gegen die Allgäu Comets aus Kempten. Auf Duelle mit den Traditionsteams Frankfurt Universe und Munich Cowboys. Auf die ultimative Herausforderung gegen den mehrfachen deutschen Meister Schwäbisch Hall. Auf ein vollbesetztes Weingartener Lindenhofstadion mit mehr als 2000 Zuschauern.

Impressum
Impressum
Frank Hautumm, Annette Vincenz, Bernd Adler, Oliver Linsenmaier, Markus Reppner, Philipp Richter, Lena Müssigmann, Ruth Auchter, Katrin Neef, Thorsten Kern, Michael Panzram, Corinna Konzett
Fotos
Eduard Frankovsky/ SZ Leser, Oliver Linsenmaier, Philipp Richter, Marlene Gempp, Steffi Rebhan, Maria Anna Blöchinger, Elke Obser, Rudi Multer, Corinna Konzett, Florian Wolf/ dpa, Jens Büttner/ dpa, Felix Kästle/dpa, Sebastian Gollnow/dpa, Wolfgang Steinhuebel, Siegfried Heiß, Stadt Weingarten, Feuerwehr Weingarten, CDU
Videos
Marcus Fey, Alexis Albrecht, Feuerwehr Ravensburg
Grafiken/ Bildbearbeitung
Alexis Albrecht
Verantwortlich
Hagen Schönherr
Copyright: Schwäbische Zeitung 2020 - alle Rechte vorbehalten.






















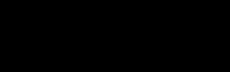







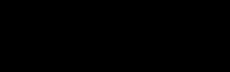


























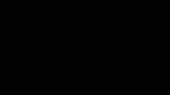







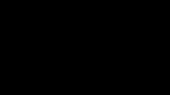






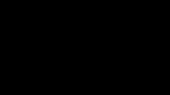












 Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
 Wie Corona das Leben in der Region verändert hat
Wie Corona das Leben in der Region verändert hat
 Wie Corona das Leben verändert hat 3
Wie Corona das Leben verändert hat 3
 Ein Katastrophenjahr für das Rutenfest
Ein Katastrophenjahr für das Rutenfest
 Ein Katastrophenjahr für das Rutenfest 2
Ein Katastrophenjahr für das Rutenfest 2
 Ein Katastrophenjahr für das Rutenfest 3
Ein Katastrophenjahr für das Rutenfest 3
 Aufsehenerregende Fälle vor Gericht
Aufsehenerregende Fälle vor Gericht
 Feuerwehr löscht Brand in Altstadt
Feuerwehr löscht Brand in Altstadt
 Polizeipräsidium ist zurück
Polizeipräsidium ist zurück
 Elektrifizierung: Großteil geschafft
Elektrifizierung: Großteil geschafft
 14 Nothelfer endgültig geschlossen
14 Nothelfer endgültig geschlossen
 14 Nothelfer endgültig geschlossen 2
14 Nothelfer endgültig geschlossen 2
 Blutritt öffnet sich für Frauen
Blutritt öffnet sich für Frauen
 Blutritt öffnet sich für Frauen 2
Blutritt öffnet sich für Frauen 2
 Blutritt öffnet sich für Frauen 3
Blutritt öffnet sich für Frauen 3
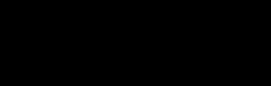 Martinshöfe nehmen Form an
Martinshöfe nehmen Form an
 Abschied von Heinrich Grieshaber
Abschied von Heinrich Grieshaber
 Ein Bus aus Ischgl brachte Corona mit
Ein Bus aus Ischgl brachte Corona mit
 Ein Bus aus Ischgl brachte Corona mit 2
Ein Bus aus Ischgl brachte Corona mit 2
 Ein Bus aus Ischgl brachte Corona mit 3
Ein Bus aus Ischgl brachte Corona mit 3
 Ein Bus aus Ischgl brachte Corona mit 4
Ein Bus aus Ischgl brachte Corona mit 4
 Alle reden vom Altdorfer Wald
Alle reden vom Altdorfer Wald
 Alle reden vom Altdorfer Wald 2
Alle reden vom Altdorfer Wald 2
 Alle reden vom Altdorfer Wald 3
Alle reden vom Altdorfer Wald 3
 Grüne sind auf dem Land angekommen
Grüne sind auf dem Land angekommen
 Eugen Abler tritt aus CDU aus
Eugen Abler tritt aus CDU aus
 70 Tiere sterben bei Brand in Baindt
70 Tiere sterben bei Brand in Baindt
 Streitpunkt Mobilfunk
Streitpunkt Mobilfunk
 Baindter wird in Brasilien getötet
Baindter wird in Brasilien getötet
 Urteil gegen Haug wird rechtskräftig
Urteil gegen Haug wird rechtskräftig
 Lange Pause, leere Ränge
Lange Pause, leere Ränge
 Lange Pause, leere Ränge 2
Lange Pause, leere Ränge 2
 Lange Pause, leere Ränge 3
Lange Pause, leere Ränge 3
 Lange Pause, leere Ränge 4
Lange Pause, leere Ränge 4
 Improvisation und Kurzarbeit statt Debüt
Improvisation und Kurzarbeit statt Debüt