Wir werden alt und unsere Ärzte auch
Wir werden alt - und unsere Ärzte auch
Dabei merken schon jetzt viele Menschen, wie schwierig es ist, einen Termin bei einem Spezialisten oder auch bei einem Hausarzt zu bekommen. Der Bedarf nach Behandlung steigt, aber die zur Verfügung stehenden Sprechstunden bei Ärzten schwinden.
Die offiziellen Zahlen aber sagen: Eine Unterversorgung droht nicht.
Wie kann das sein?
Wo Zahlen und Realität auseinander driften
Wo Zahlen und Realität auseinander driften

Die Ärztestatistik weist für 2022 bundesweit 421.000 berufstätige Ärztinnen und Ärzte aus. Das ist ein minimaler Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Trotzdem dürfe laut der Kammer bezweifelt werden, dass das deutsche Bildungssystem eine ausreichende Anzahl an Ärzten hervorbringt.
Aber wie passt das zusammen?
Zum einen steigt der Bedarf an Behandlungen. Allein bei Diabeteserkrankungen rechnet das Deutsche Diabetes-Zentrum mit einem Anstieg um bis zu 77 Prozent bis zum Jahr 2040.
Zum anderen folgen auch die Ärzte dem gesamtgesellschaftlichen Trend hin zu weniger Überstunden und kürzerer Arbeitszeit.
Wenn also der Hausarzt im Dorf, der bislang 45 Stunden jede Woche Sprechzeiten für Patienten angeboten hat, in den Ruhestand geht, sein Nachfolger aber nur noch 40 Stunden anbietet, dann ist die Zahl der Ärzte auf dem Papier gleich geblieben. In der Realität steht aber weniger Zeit zur Verfügung.
Und selbst das funktioniert nur, wenn der Dorfarzt überhaupt einen Nachfolger findet.
Der Ruhestand kommt - und dann?
Der Ruhestand kommt - und dann?


Zwischen Alb und Bodensee ist jeder dritte Arzt über 60.
Diese Ärzte gehören noch zur Generation der Baby-Boomer und sind in den geburtenstarken Jahren der 1950er und 1960er auf die Welt gekommen. Es ist eine Folge des demografischen Wandels, dass es von ihnen mehr gibt als in den Generationen, die folgen.
Wenn sie in den nächsten Jahren aus dem Berufsstand ausscheiden, wird das eine Lücke hinterlassen.

So alt sind unsere Ärzte
Jeder Dritte Arzt ist über 60
Wie viele und welche Ärzte konkret das betreffen wird, sei schwer zu beurteilen, hat Sprecher Kai Sonntag auf Nachfrage erläutert. Was aus dem Bericht jedoch abzulesen ist, ist die Altersstruktur der Ärzte in jedem Landkreis.
Eine Auswertung dieser Zahlen durch Schwaebische.de zeigt: Je nach Fachrichtung sind in manchem Landkreis schon jetzt bis zu 60 % der Ärzte einer Fachrichtung über 60 Jahre alt.
Scrollen Sie weiter, um die Lage in Ihrem Landkreis zu sehen.
Anteil der Ärzte über 60 auf einer Karte
Bedarfsplanung
Trotzdem heißt es offiziell: Es droht keine Unterversorgung
So zumindest steht es in der sogenannten Bedarfsplanung des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen für Baden-Württemberg. Sie bestimmt zum Beispiel, wo sich noch neue Ärzte niederlassen können und wo nicht.
Das Problem: Eigentlich sind die Angaben in der Bedarfsplanung gar nicht dafür geeignet, die Versorgung in der Region abzulesen.
Was ist eigentlich die Bedarfsplanung?
Was ist eigentlich die Bedarfsplanung?

Der Versorgungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis zwischen der Anzahl an Ärzten und der Anzahl an Einwohnern in einem definierten Gebiet. So kann er in Prozent angegeben werden.
Entstanden ist er Anfang der 1990er Jahre, als die Bundesregierung von einer Ärzteschwemme ausging und einen Kostenanstieg bei den Krankenkassenbeiträgen verhindern wollte. Dafür wollten sie die Anzahl der Ärzte in einem Gebiet begrenzen.
So wird der Versorgungsgrad bestimmt
Weil es aber bis heute kein wissenschaftliches Maß dafür gebe, wie gut die Versorgung in einer Region sei, erklärt KVBW-Sprecher Kai Sonntag, habe man sich pragmatisch auf etwas geeinigt. Als 100 Prozent versorgt gilt eine Region dann, wenn das Verhältnis zwischen Ärzteanzahl und Einwohnern auf dem Niveau von 1990 liegt.
Übersteigt der Versorgungsgrad 110 Prozent in einem Planungsbereich, wird dieser für neue Zulassungen gesperrt. Es können sich also keine weiteren Ärzte dort niederlassen. Nur in wenigen Regionen in Baden-Württembergs Südwesten ist das der Fall.
Scrollen Sie weiter, um beispielhaft die Bedarfsplanung für Hausarzt-Sitze zu erkunden.
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: gesperrt
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: gesperrt
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Status: offen
Ulm
Versorgungsgrad: 109,7
Status: offen
Ellwangen
Versorgungsgrad: 81,9
Status: offen
Härtsfeld
Versorgungsgrad: 95,5
Status: offen
Schwäbischer Wald
Versorgungsgrad: 67,9
Status: offen
Aalen
Versorgungsgrad: 96,2
Status: offen
Schwäbisch Gmünd
Versorgungsgrad: 99,2
Status: offen
Göppingen
Versorgungsgrad: 85,2
Status: offen
Geislingen
Versorgungsgrad: 81,8
Status: offen
Heidenheim
Versorgungsgrad: 93,2
Status: offen
Blaubeuren / Laichingen
Versorgungsgrad: 92,2
Status: offen
Münsingen
Versorgungsgrad: 111,4
Status: gesperrt
Ehingen
Versorgungsgrad: 97,4
Status: offen
Laupheim
Versorgungsgrad: 101,4
Status: offen
Albstadt
Versorgungsgrad: 88,2
Status: offen
Sigmaringen
Versorgungsgrad: 79,0
Status: offen
Riedlingen
Versorgungsgrad: 91,4
Status: offen
Biberach
Versorgungsgrad: 104
Status: offen
Tuttlingen
Versorgungsgrad: 85,9
Status: offen
Pfullendorf
Versorgungsgrad: 86,8
Status: offen
Bad Saulgau
Versorgungsgrad: 78,2
Status: offen
Bad Waldsee
Versorgungsgrad: 94,2
Status: offen
Leutkirch
Versorgungsgrad: 106,2
Status: offen
Donaueschingen
Versorgungsgrad: 81,3
Status: offen
Stockach
Versorgungsgrad: 116,3
Status: gesperrt
Singen
Versorgungsgrad: 93,6
Status: offen
Radolfzell
Versorgungsgrad: 94
Status: offen
Konstanz
Versorgungsgrad: 108,8
Status: offen
Überlingen
Versorgungsgrad: 103,4
Status: offen
Ravensburg / Weingarten
Versorgungsgrad: 104,1
Status: offen
Friedrichshafen
Versorgungsgrad: 100,2
Status: offen
Wangen
Versorgungsgrad: 95,3
Status: offen
Das Problem mit dem Versorgungsgrad
Das Problem mit dem Versorgungsgrad


Er sieht drei zentrale Probleme der Bedarfsplanung:
- Es ist nicht klar, ob die Verhältniszahl überhaupt stimmt.
Niemand hat je geprüft, ob die Versorgung 1990, was als Referenz für 100 Prozent gilt, wirklich ausreichend war. - Jeder Arzt, der mindestens 25 Stunden Sprechzeiten für Kassenpatienten pro Woche anbietet, zählt in die Statistik mit hinein. Egal, ob es 30 oder 40 Stunden sind, der Arzt wird als "1" gezählt.
Das ist besonders durch die Tendenz gefährlich, dass junge Ärzte häufig weniger Sprechstunden machen, als die Ärzte, die in Rente gehen. - Der Versorgungsgrad wird auf sogenannte "Mittelbereiche", rund um ein Zentrum berechnet, nicht pro Gemeinde.
Er setzt also voraus, dass die Einwohner auch mal bereit sind, ans andere Ende dieses Bereiches zu fahren, um einen Hausarzt zu finden.
Eine richtige Alternative gibt es jedoch kaum. Denn schon die Frage: Was ist eigentlich gute Versorgung? lässt sich nur schwer beantworten.
Geht es dabei allein darum, wie schnell man einen Termin kriegt? Sollte das aber nicht je nach Art der Beschwerde unterschiedlich gewichtet werden? Gilt eine Hausarztpraxis im Nachbarort noch als gute Versorgung oder braucht jede Gemeinde eine? Welche Rolle spielt die Qualität der Praxen?

Zurück in die Praxis
Lösungen sind noch weit entfernt
Lösungen sind noch weit entfernt

Das merke die KVBW zum Beispiel daran, wie viele Anfragen sie von Menschen bekommt, die keinen Hausarzt mehr finden. Wenn in den nächsten Jahren all die Ärzte über 60 auch noch aus dem Beruf ausscheiden, wird das Problem weiter wachsen. Denn von den Unis kommt nicht genug nach.
„Es ist jetzt schon klar, dass nicht jede Praxis einen Nachfolger finden wird“, gesteht Sonntag. Welche Praxen das konkret betreffen wird, lässt sich allerdings nicht voraussagen. „Wir wissen nur insgesamt, dass wir ein Problem bekommen und ein Problem haben.“
Das wird schon getan
Die KVBW versucht dem entgegenzuwirken, etwa durch bestimmte Förderprogramme für Regionen und einzelne Gemeinden, in denen sie einen dringenden Bedarf sieht – und den liest sie nicht nur am Versorgungsgrad ab. Dafür würden zum Beispiel auch die Größe der Gemeinde, der Altersdurchschnitt der Bevölkerung oder auch die Entfernung zu anderen Praxen herangezogen, erklärt Sonntag.
„Wir werden das Problem als KV nicht allein lösen können“, stellt er auch klar. „Wir können uns ja keine Ärzte backen.“
Weiter greifende Lösungen sind jedoch schwer zu finden und brauchen häufig viel Vorlaufzeit. Mehr Studienplätze etwa seien zwar gut, aber mehr Ärzte gebe es dadurch frühestens in zwölf Jahren. Und auch die Frage, wie attraktiv die betroffene Gemeinde insgesamt ist, spiele eine Rolle. Will sich dort jemand neu niederlassen – und dort wohnen?
Ein Blick in die Zukunft
Es ist ein Problem, das weiter wachsen wird und sich trotzdem nur schlecht beziffern lässt. Mancherorts wird es vielleicht gut ausgehen, andere Gemeinden werden möglicherweise keine Nachfolger für ihre Ärzte finden. Konkrete Prognosen? So gut wie unmöglich.
Kai Sonntag bleibt trotzdem positiv. „Trotz aller Probleme, die wir haben, haben wir in Baden-Württemberg im internationalen Vergleich eine exzellente Versorgung“, sagt Sonntag und versichert: „Die wird vielleicht zurückgehen, aber sie wird exzellent bleiben.“
Impressum
Recherche, Texte und Umsetzung:
Maike Daub
Fotos:
Pexels, Pixabay, KVBW
Grafiken:
Statistisches Bundesamt (Demografischer Wandel)
KVBW (Bedarfsplanung)
Maike Daub (Ärzte über 60)
Kontakt:
Schwäbische Zeitung Biberach
Marktplatz 35
88400 Biberach
www.schwaebische.de





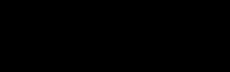
















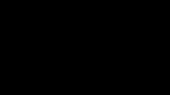






 Wir werden alt - und unsere Ärzte auch
Wir werden alt - und unsere Ärzte auch
 Wo Zahlen und Realität auseinander driften
Wo Zahlen und Realität auseinander driften
 Der Ruhestand kommt - und dann?
Der Ruhestand kommt - und dann?
 Jeder Dritte Arzt ist über 60
Jeder Dritte Arzt ist über 60
 Trotzdem heißt es offiziell: Es droht keine Unterversorgung
Trotzdem heißt es offiziell: Es droht keine Unterversorgung
 Was ist eigentlich die Bedarfsplanung?
Was ist eigentlich die Bedarfsplanung?
 Bedarfsplanung
Bedarfsplanung
 Das Problem mit dem Versorgungsgrad
Das Problem mit dem Versorgungsgrad
 Lösungen sind noch weit entfernt
Lösungen sind noch weit entfernt
 Ein Blick in die Zukunft
Ein Blick in die Zukunft
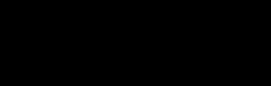 Impressum
Impressum
 Augenärzte
Augenärzte
 Internisten
Internisten
 Chirurgen und Orthopäden
Chirurgen und Orthopäden
 Kinder- und Jugendärzte
Kinder- und Jugendärzte
 Psychotherapeuten
Psychotherapeuten
 Gynäkologen
Gynäkologen